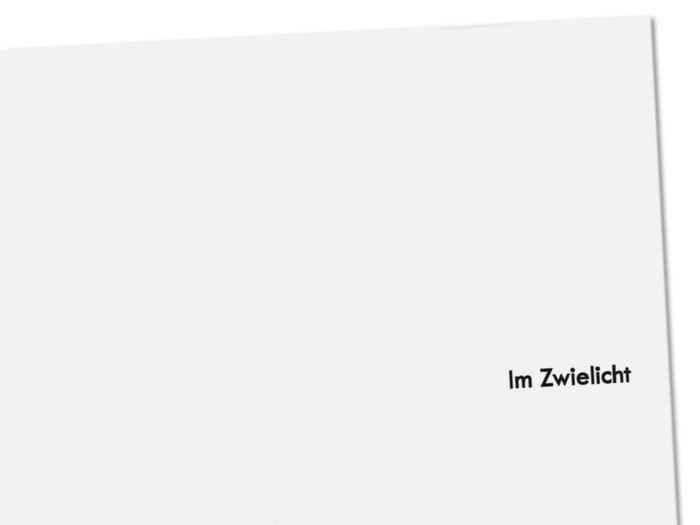
Eine ARD-Doku hilft Christian Schertz dabei, sich als #MeToo-Vorkämpfer zu inszenieren

Am Montag lief im Ersten eine einstündige Dokumentation über Christian Schertz, laut Ankündigung „der bekannteste und gefürchtetste Presseanwalt Deutschlands“. Und zum Schluss, als der Film schon gezeigt hat, wie unersetzlich dieser „Star-Anwalt“ ist, um der Klatschlügenpresse Grenzen zu setzen; wie selbstlos er für das Recht auch der Unsympathen kämpft; wie sehr er die Kunst liebt und die Künstler; wie wichtig es ihm ist, dass wir nicht in den Puritanismus der Adenauerzeit zurückfallen, und wie gut er der Versuchung widersteht, als Jurist in Empörung zu verfallen – nachdem der Film also all das schon gezeigt hat, inszeniert er Christian Schertz auch noch als denjenigen, der #MeToo nach Deutschland geholt hat. Der dafür gesorgt hat, dass der Regisseur Dieter Wedel in seinen letzten Lebensjahren eine Unperson war und dass den Schauspielerinnen, die seine Opfer wurden, eine Art Gerechtigkeit widerfahren ist, weil ihre Erlebnisse an die Öffentlichkeit kamen, in einem großen Artikel im Magazin der „Zeit“.
Und das, wenigstens das, sollte man Christian Schertz und diesem Film dann doch nicht durchgehen lassen.
Die „riskanteste Recherche“
Die Schauspielerin Jany Tempel hatte Wedel vorgeworfen, sie bei einem Vorsprechen 1996 zum Sex gezwungen zu haben. Auch andere Schauspielerinnen bezichtigten ihn in dem Artikel, der Anfang 2018 erschien, gewalttätiger und sexueller Übergriffe.
„Was bislang nur wenige wissen“, sagt die Off-Sprecherin in der ARD-Dokumentation, „Christian Schertz hat den Frauen geholfen, dass diese Geschichte rauskommt.“ Jany Tempel hatte sich an ihn gewandt; Schertz hat dann den Kontakt zur „Zeit“ hergestellt.
In der ARD-Doku heißt es über die Wirkung:
„Ein ganzes langjähriges System des Machtmissbrauchs wird freigelegt. Schertz hat dabei eine besondere Rolle. Er hilft den Frauen mit den Medien. Aber er prüft auch, dass sie sich so äußern, dass Dieter Wedel sie nicht verklagen kann.“
Die Beteiligten feiern sich und einander in der Doku, und sie werden von ihr gefeiert. Die Autorinnen des Artikels erzählen, wie viel Angst die betroffenen Frauen hatten, und dass es für sie „super super hart“ gewesen sei, an die Öffentlichkeit zu gehen. „Zeit“-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo erzählt, dass es die „sicher riskanteste Recherche“ des Blattes während seiner Amtszeit war, „nicht nur wegen der hohen Verantwortung, die wir gegenüber dem Täter hatten, sondern da stand auch die Reputation des ganzen Blattes auf dem Spiel“. Er attestiert Schertz, dass er „Interesse hatte an Aufklärung“ und „aus einer inneren Überzeugung“ dabei geholfen habe, dass die Geschichte zustande kam.
Und Nora Binder, die Autorin der ARD-Dokumentation, lässt die Off-Sprecherin sagen:
„Den Journalistinnen ist damit ein Scoop gelungen. Diese Verdachtsberichterstattung gilt bis heute als vorbildlich.“
Das ist eine steile Behauptung. Und ein Schlag ins Gesicht mindestens einer der Frauen, die damals der „Zeit“ und Christian Schertz vertraut haben: Jany Tempel. Sie fühlte sich von beiden verraten und im Stich gelassen und hat dafür gekämpft, dem Artikel die damals erhaltenen Journalistenpreise abzuerkennen.
Eine Frage der Verjährung
Eine wichtige Rolle spielt die Frage, ob die Taten, die sie Dieter Wedel vorwarf, strafrechtlich verjährt waren. Die „Zeit“ behauptete das damals, auch in ihrer Berichterstattung: „Sexualstraftaten verjähren (…) spätestens nach 20 Jahren.“ Doch das stimmt nicht. Seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2015 beginnt die Verjährungsfrist frühestens mit Ablauf des 30. Lebensjahres des Opfers. Das heißt im konkreten Fall: 2019 – also nach der Veröffentlichung des Artikels.
Die Staatsanwaltschaft begann deshalb, gegen Wedel zu ermitteln – und Jany Tempel musste gegen ihn aussagen. Auch Menschen aus ihrem Umfeld wurden nun vernommen. Weitere mutmaßliche Opfer Wedels, die sich nur anonym geäußert hatten, wurden als Zeuginnen im Strafverfahren nun namentlich benannt. Vor allem für Tempel war es eine riesige psychische Belastung.
Sie sagte später, sie hätte sich nie bereit erklärt, ihre Geschichte zu veröffentlichen, wenn sie gewusst hätte, dass sie noch nicht verjährt ist. Sie warf der „Zeit“ vor, sie falsch beraten zu haben. Auch eine andere Frau sagte angesichts der unerwarteten Konsequenzen, sie hätte im Wissen darum ihre Geschichte nie erzählt, auch anonym nicht.
Die „Zeit“ bestritt, Tempel und die anderen mutmaßlichen Opfer überhaupt in dieser Frage beraten zu haben, und behauptete, sie habe nicht gewusst, dass denen das überhaupt wichtig gewesen sei. „Zeit“-Chefredakteur di Lorenzo schrieb Tempel, er habe es sich nicht vorstellen können, dass drei Anwälte übersehen könnten, dass der Fall noch nicht verjährt sei. Er meinte damit offenbar den Strafverteidiger Johann Schwenn, mit dem die „Zeit“ schon häufiger zusammengearbeitet hat, den Medienanwalt der „Zeit“ – sowie Christian Schertz.
„Vertrauen rücksichtslos ausgenutzt“
Wenige Wochen nach der Veröffentlichung des ersten Artikels, kurz nach der Aufnahme der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen kam es zu einem Krisengespräch zwischen Chefredaktion und Autorinnen der „Zeit“, mutmaßlichen Opfern und Schertz in der Berliner Kanzlei des Anwalts. Es führte allerdings zu keiner Klärung, sondern zum endgültigen Bruch zwischen Jany Tempel einerseits und der Zeitung und dem „Star-Anwalt“ andererseits. Später folgte eine gerichtliche Auseinandersetzung um die Frage, wer die Kosten für einen Strafrechtsanwalt für Jany Tempel trägt: Sie behauptet, die „Zeit“ habe ihr wegen der angeblichen falschen Beratung zugesagt, alle Rechtskosten zu übernehmen, auch die, die im Strafverfahren anfallen. Die „Zeit“ bestreitet das und setzte sich nach einem erbitterten Rechtsstreit vor Gericht durch.
Im Zuge der Auseinandersetzung formulierten Tempel und ihr Anwalt Alexander Stevens weitere Kritik an der „Zeit“: Zwei weitere mutmaßliche Opfer Wedels hätten der Zeitung vorgeworfen, ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden zu sein. Jany Tempel habe den Eindruck, „dass die ‚Zeit‘ möglicherweise ihr Vertrauen und das der anderen betroffenen Frauen rücksichtslos ausgenutzt hat, um unter dem Deckmantel des Opferschutzes eine auflagenstarke Story zu veröffentlichen.“
So hatte eine der Frauen, die mit der „Zeit“ gesprochen hatte, die Zustimmung, ihre Geschichte anonym veröffentlichen zu dürfen, noch vor der Veröffentlichung zurückgezogen. Ihr Fall wurde trotzdem im Artikel geschildert. Die „Zeit“ verteidigte das damit, dass er auch von anderen Zeugen beschrieben worden sei.
„Kachelmann ist unschuldig, Wedel ist schuldig“
Die langjährige Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen berichtete Ende 2018 in der „Welt“ ausführlich über die Auseinandersetzungen um die Veröffentlichung. Übermedien berichtete 2019 über den Rechtsstreit zwischen Jany Tempel und ihrem Anwalt und der „Zeit“.
Die Dieter-Wedel-Berichterstattung führte auch zum Bruch zwischen dem damaligen „Zeit“-Kolumnisten Thomas Fischer und dem Blatt. Fischer, ehemaliger Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, hatte Anstoß an dem ersten „Zeit“-Artikel genommen, in dem er eine „aufdringlich tendenziöse Beschuldigungs-Tendenz“ ausmachte.
Auf seinen Vorhalt, die „Zeit“ mache mit Wedel dasselbe, was sie bei Jörg Kachelmann der „Bild“-Zeitung vorwarf, habe die damalige stellvertretende „Zeit“-Chefredakteurin Sabine Rückert geantwortet: „Kachelmann ist unschuldig, Wedel ist schuldig.“
Von wegen „vorbildlich“
Um die Dieter-Wedel-Berichterstattung der „Zeit“ entwickelte sich eine ausufernde Auseinandersetzung, die teilweise von außen schwer nachzuvollziehen ist. Aber unabhängig davon, wie man die gegenseitigen Vorwürfe beurteilt: Die Aussage der ARD-Dokumentation, „diese Verdachtsberichterstattung gilt bis heute als vorbildlich“, ist verwegen. Das lässt sich schon daran erkennen, dass mindestens eines der mutmaßlichen Opfer Wedels – ausgerechnet die Frau, die alles ins Rollen gebracht hat – bis heute erbittert gegen diesen Eindruck kämpft.
Man kann es zwiespältig finden, wenn ein mutmaßliches Opfer gravierende Vorwürfe gegen einen mutmaßlichen Täter nur unter der Bedingung veröffentlichen will, dass sie strafrechtlich nicht mehr überprüft werden können. Aber es ist letztlich ihre Entscheidung – und es wäre ein gravierendes Problem, falls sie von hochkarätigen Anwälten und dem Medium, dem sie sich öffnet, falsch informiert wurde. Christian Schertz ist kein Strafrechtsanwalt, die Verjährung nicht sein Spezialgebiet. Aber wäre die sorgfältige Klärung dieser Frage nicht auch seine Verantwortung gewesen?
Schertz begleitete Jany Tempel nach Angaben der Schauspielerin sogar zur ersten, mehrstündigen Zeugenvernehmung durch die Staatsanwaltschaft. Erst von der Kommissarin sei sie darauf hingewiesen worden, dass sie sich dafür besser einen Strafrechtsanwalt nähme statt eines Medienanwaltes, erzählte sie.
Schertz‘ genaue Rolle im Hintergrund ist undurchsichtig. Damals sollte sein Wirken offenbar nicht öffentlich werden. Und nun, Jahre später, als Teil eines Denkmals, das die ARD ihm baut, brüstet er sich mit seinen Verdiensten in dieser Sache?
Die Dokumentation endet voller Pathos mit den Sätzen:
„Warum hat er mit dem Fall Wedel die erste große #MeToo-Geschichte in Deutschland öffentlich machen wollen? Die Beweise waren letztlich erdrückend. Trotzdem wusste er das ganz am Anfang noch nicht.
Am Anfang saß da nur eine Frau, der er glaubte.“
Eine Frau, die wegen der Konsequenzen mit ihm gebrochen hat, aber das erwähnt niemand in dieser Dokumentation.
Stattdessen darf Schertz sagen, was er den Frauen damals versprochen habe: „Ich hab gesagt: Ihr könnt das machen, ich werd‘ euch schützen.“
Weg mit der „moralischen Latte“
Diese ganze Inszenierung von Schertz als Mensch, der auf der Seite mutmaßlicher Opfer von Machtmissbrauch steht, der sich darum kümmert, dass Dinge an die Öffentlichkeit kommen: Sie hat eine wichtige Funktion in dem Film und der (Selbst-)Darstellung von Schertz, weil sie einen Kontrast zu seiner Rolle als Anwalt von Till Lindemann bildet. Im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen den Rammstein-Sänger pocht Schertz auf die Unschuldsvermutung; darauf, wie wichtig es sei, jemanden nicht öffentlich zu stigmatisieren, egal wie unsympathisch einem sein Verhalten erscheinen mag.
Er erzählt, dass er auch von Mandantinnen dafür kritisiert worden sei, Lindemann zu vertreten, aber letztlich gehe es nicht um Moral, sondern einfach um das Recht. Angesichts der Empörung über den Umgang des Sängers mit jungen Frauen und der dazu scheinbar passenden Gewaltfantasien in seinen Texten warnt Schertz: „Wenn man da jetzt anfängt, die moralische Latte anzusetzen, wie musst du dich verhalten, um diesem moralischen Ansprüchen gerecht zu werden, sind wir fast im puritanischen Adenauer-Deutschland gelandet.“
Über Lindemann sagt Schertz: „Dass ein Star und ein Fan miteinander sich näher kommen und auch miteinander ins Bett gehen, ist so alt wie der Rock’n Roll.“ Über Wedel sagt Schertz nicht: „Dass der Weg zu guten Rollen über eine Besetzungscouch führt, ist so alt wie Hollywood.“
Stattdessen sagt er über Dieter Wedel: „Es gilt auch da die Unschuldsvermutung, aber da war ich nun mal auf der anderen Seite.“ Und von dieser anderen Seite aus formuliert er dann noch unbekümmert:
„Er war Täter, im übertragenen Sinne auf jeden Fall. Das Verfahren gegen ihn konnte ja nicht zuende geführt werden, weil er dann verstarb.“
Man müsste mal testen, wie schnell man Anwaltspost von der Kanzlei Schertz Bergmann bekäme, wenn man über einen ihrer Mandanten vor einem Urteil schriebe: „Er war Täter, im übertragenen Sinne auf jeden Fall.“
Jany Tempel sieht sich inzwischen als Opfer nicht nur von Dieter Wedel, sondern auch der „Zeit“. Thomas Fischer hatte Ende 2018 geschrieben: „Es scheint fast, als gebe es im großen Wedel-Tribunal der ‚Zeit‘ nur einen einzigen Gewinner: sie selbst.“ Dank der ARD-Doku kann man jetzt wenigstens Christian Schertz auch dazu zählen.
Offenlegung: Ich komme selbst in der Doku vor und äußere mich darin über Christian Schertz und seine Methoden, allerdings nicht zum Fall Wedel.
Der Autor

Stefan Niggemeier ist Gründer von Übermedien und „BILDblog“. Er hat unter anderem für „Süddeutsche Zeitung“, „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ und den „Spiegel“ über Medien berichtet.
Bedauerlich das öffentliche Ressourcen immer wieder für private Profilierungen missbraucht werden.
Was hatte die Redaktion der ARD davon?
Bei mir hinterlässt es den Eindruck, als solle der Anwalt von Hrn. Lindemann ein paar Vorschusslorbeeren erhalten. Genau in dem Themenbereich, in welchem zukünftig von Ihm noch zu hören sein wird.
Und die Betroffenen werden weiter rücksichtslos geschädigt.
Zum Kommentar von Herrn Rene S. Die öffentlichrechtlichen Ressourcen werden auch im Fall Lindemann fleissig genutzt. Abmahnungen inklusive. Irgendwie läuft da viel aus dem Ruder. Meines Erachtens dienten und dienen Frau Tempel und Herr Lindemann dem Umsatz. Das ist alles.
Diesen Artikel hab ich mit Spannung gelesen. Ich kannte das, was Frau Tempel erlebt hat, nicht. Und es tut mir leid. Bin nicht aus Deutschland. Dass aber ein Vergleich mit Lindemann auch noch herhalten muss, so als Wertung der Moral des Anwalts, obwohl es da so viele Ungereimtheiten in der Berichterstattung gibt, versteh ich nicht. Da will man einer Person helfen, was ich verstehe, und stellt die Andere als „wäre er verurteilt“ dar. Eigentlich nur, um einen Anwalt zu kritisieren. Oder gehts um die Art des Berichts der ARD? Ich kriegs nicht recht auseinander so. Ist mir zu vermischt. Aber ich hab für mich die mir nicht bekannte Geschichte von Frau Tempel „herausgeschält“. So gesehen…immerhin.
Da dies mein letztes Abo ist, das ich überhaupt noch habe. Warte noch etwas ab. Dann heisst es wohl auch hier ready steady go.
Kann es eigentlich sein – nur „laut gedacht“ und so – dass man seinerzeit Frau Tempel einfach mit Absicht falsch informiert hat, um die Story nicht zu gefährden?
Von den konkreten Fällen abstrahiert: im Detail halte ich das Verhältnis „Fan-Star“ nicht für _so_ problematisch wie das Verhältnis „Arbeitnehmer-Arbeitgeber“, insofern ist es egal, wie „alt“ das jeweils ist. Schon wegen der Frage, wer von wessen Geld abhängig ist.
@#2: Auch wenn ich jetzt ein bisschen wie der Anwalt dieses Artikels wirken mag: Ich habe das Beispiel Lindemann so verstanden, dass damit das widersprüchliche Kommunikationsverhalten von Herrn Schertz illustriert werden sollte. Nicht aber, um festzustellen, dass Lindemann definitiv schuldig ist, wie man es Dieter Wedel unterstellt.
Aber ich kann Ihre Sichtweise dennkchnachvollziehen.
Diese verkappte Drohung mit der Abokündigung ist dagegen kindisch. Wenn Sie nur Medien abonnieren, die stets Artikel schreiben, die einzig und allein Ihre Sichtweise widerspiegeln, dann lesen Sie besser den Kicker oder die Auto, Motor & Sport.
@Sid (#4):
Ich auch. Wobei die Kritik hier eigentlich nur die Doku trifft, die Herrn Schertz als Kämpfer für die gute Sache in Szene setzt. Das ist aber nicht die Aufgabe eines Anwalts – der hat stets die Interessen seiner jeweiligen Mandantschaft zu vertreten.
Will sagen: Wenn er ein mutmaßliches Missbrauchsopfer vertritt, spricht er anders, als wenn sein Mandant der mutmaßliche Täter ist. Das ist aber eigentlich nicht widersprüchlich, sondern gehört zum Job.
Die Stilisierung zum Helden der #MeToo-Debatte finde ich problematisch. Die Verdammung als „Täteranwalt“ aber auch. Es ist ein zivilisatorischer Fortschritt, dass auch Leute einen Rechtsbeistand haben, die von der Öffentlichkeit schon für schuldig befunden worden. Moralische Anklagen gegen so einen Rechtsbeistand sollte man sich sparen. (Otto Schily und Hans-Christian Ströbele können/konnten ein Lied davon singen.)
@Sid#4
Ja ich gebe zu. Es war eine kindische Reaktion von mir. Danke für Ihr Feedback. Es ist nur so, dass bei mir ein Verdruss herrscht. Ich bin Leserin, habe nichts mit Journalismus zu tun. Ich bin gegen 60 Jahre alt und irgendwie verliere ich immer mehr das Vertrauen, dass ich ganz selbstverständlich über Jahre hatte. Ich möcht mich in der Zukunft nicht über Youtube oder SoMe „informieren“. Ich halte darum „Riesenstücke“ auf das Medium hier. Hab mich wieder beruhigt. Danke @Sid
@#5: Das stimmt. Anwälte als Vorkämpfer(!) der Sache des jeweiligen Mandanten? Da kriegt man schon ein wenig einen Knoten in den Kopf. Vor dem Hintergrund ist es fast albern, dass Dokus (nicht nur die hier besprochene) so gerne Heldengeschichten darstellen, obwohl sie das doch gerade nicht tun sollten.
@#6: Immer gern.: )
Mit dem Einzug des Internet und spätestens mit den Sozialen Medien ist es sehr viel schwieriger geworden, sich zu relevanten Themen zu informieren, ohne sich von (Ich sag’s mal freundlich) Desinformation ablenken bzw. irritieren zu lassen. Aber gerade deshalb finde ich es wichtig, dass es Portale wie Übermedien gibt (Dürft ihr gern als Kompliment verstehen), die andere Perspektiven suchen und darstellen. Ich bin auch nicht mit allem einverstanden hier und manchmal ist es ne ganze Spur over the top. Aber unter uns: Ich ertappe mich selbst auch manchmal bei Dummheiten. Die Mischung macht’s. Meine Meinung.
Guter Text hier, danke – schlimmer Film dort. Alle Schertz-Gags gemacht,meine Kritik geht ganz woanders hin: Ganz ehrlich: Handwerklich – filmisch doch nicht auszuhalten. Ich kenne Berlin bei Nacht, die Textblöcke mit derart furchtbaren, nicht passenden Footage vom Späti auszustatten-was war das? Rappelkiste mit BvSB? Sollte das cool sein, jaja, ein bisschen Feenstaub in Sachen Kunst und Literatur, oh jeee, was für eine Autorenhandschrift insgesamt.
Ich habe auch eine Kritik zur Doku geschrieben (erscheint Dienstag), aber diese Hintergründe waren mir nicht bekannt. Ich werde sie um einen Hinweis auf diesen Text ergänzen.
Davon abgesehen finde ich aber nicht, dass die Doku Schertz durchgehen lässt, sich als Helden zu inszenieren. Der ganze Aufbau zielt nach meinem Gefühl darauf ab, zu zeigen, wie eitel es von Schertz ist, nicht nur Anwalt zu sein sondern auch Richter zu spielen, und dass er am Ende oft der Hauptprofiteur ist. Aber gut möglich, dass das nicht eindeutig genug ist.
Das Wort „scheinbar“ bedeutet „macht fälschlicherweise den Eindruck“. Den Satz „Angesichts der Empörung über den Umgang des Sängers mit jungen Frauen und der dazu scheinbar passenden Gewaltfantasien in seinen Texten warnt Schertz:“ könnte man also bedeutungsgleich umformulieren in „Angesichts der Empörung über den Umgang des Sängers mit jungen Frauen und der Gewaltfantasien in seinen Texten, die den Eindruck machen, als passten sie zu diesem Umgang, es aber nicht tun, warnt Schertz:“. Ist es möglich, dass hier stattdessen das Wort „anscheinend“ gemeint ist, das ja „macht den Eindruck“ bedeutet? Oder wird hier aus der Perspektive von Schertz geschrieben, der ja im Sinne von Lindemann argumentieren will?
Danke für die Einordnung, Herr Niggemeier!
@8, jörg
Darauf zielt auch meine Kritik. Wenn im Abspann sechs (!) Namen unter „Design“ aufgelistet werden, dass zeigt das m.E. die Schieflage dieser Doku ganz gut.
Ich fand schon diese Kino-Film-Klappe sehr lustig. Hat vermutlich erst die Requisite beschaffen müssen. Dann diese abendlichen Straßenszenen, die nullkommanichts mit dem Text zu tun hatten und „irgendwie cool“ wirken sollen.
Vielleicht wollen sie alle so sein, wie sie sich Netflix vorstellen. Herr Schertz geht am Fenster auf und ab, das Ganze wird auch schemenhaft von der Straße aus gefilmt. Vielleicht aber geht Herr Schertz normalerweise nie am Fenster auf und ab – auch das Teil des Design-Pakets?
Es wirkt so viel, zu viel inszeniert. Und wenn man so etwas macht, dann kann sich womöglich auch so ein Gedanke einschleichen, bestimmte Inhalte nicht mehr wahrhaben zu wollen, die so gar nicht in diese Inszenierung hineinpassen. Dann ist die Doku beinahe schon vor dem ersten Drehtag in trockenen Tüchern, man muss nur noch ein Drehbuch abfilmen.
Ich empfand die Doku eher nicht als Denkmal, sonder für mich hat sie gezeigt, wie sehr der Anwalt in eigener Sache agiert. Auch das Messen mit zweierlei Maß wird recht deutlich. Auch seinen Habitus bei seinen Rechtfertigungen fand ich irritierend. Ich hatte den Eindruck, als solle das für sich sprechen, weshalb auf eine Einordnung verzichtet wurde. Offenbar kein gutes Stilmittel, wenn viele den Eindruck haben, Schertz komme gut bei der Doku weg. Das dieser Eindruck beim Wedel-Teil entstehen könnte, leuchtet mir ein, aber im Kontext der ganzen Doku? Vielleicht wurde hier zu sehr der Fokus auf Ausgewogenheit gelegt, um möglichst nicht angreifbar zu sein. Dass die Kritik an der Wedel-Berichterstattung nicht vorkam und diese gar als vorbildlich dargestellt wird, hat mich allerdings auch stutzig gemacht. Es war aber eher so ein Gefühl, dass da was nicht ganz ausgewogen ist. Dieser Artikel hier hat mich dann aufgeklärt. Kann dieser Aspekt den Journalisten komplett entgangen sein, spätestens bei der Recherche?
Ich stimme Nils #13 vollinhaltlich zu. Ich habe mir das gestern Abend endlich auch angeschaut und finde nicht, dass Schertz wirklich gut wegkommt. Es wäre natürlich schöner gewesen, wenn die Autorin das auch mal ausgesprochen hätte, und sich nicht nur in Andeutungen ergeht und den O-Ton so im Raum stehen lässt. Dafür gab es ja Deinen Kommentar, lieber Stefan, „der in drei Sätzen über Schertz mehr sagt als der Autorinnenkommentar im ganzen Film“.
@Nils, SvenR: Ich fände das überzeugender, wenn sich die Autorin wirklich eines Kommentars enthalten hätte und den Zuschauer so im Grunde aufgefordert hätte, sich ein eigenes Bild zu machen. Aber sie kommentiert halt doch und spricht sogar immer wieder für ihn.
Und hätte man nicht, zum Beispiel, mal einen Konkurrenten von Schertz fragen können? Es ist nämlich tatsächlich nicht so, dass es nur diesen einen Medienrechtler in Deutschland gibt, auch nicht den einzigen, der Prominente vertritt, obwohl man nach dem Ansehen des Filmes leicht glauben könnte.
(Ich habe übrigens im Übermedien-Newsletter noch ein paar weitere Gedanken zu Schertz aufgeschrieben.)
@Stefan #15: Da hast Du Recht, dass sie das hätte besser machen können, nein sogar müssen. Meiner Meinung kommt Schertz aber nicht sooooooo positiv rüber, wie Thomas Fischer und Du es kritisieren. Eure „professionellen Deformationen“ zusammen mit dem persönlichen Kennen verursachen da größere Schmerzen – so lese ich das zumindest – als bei einem unbeteiligten interessierten Laien, wie mir. Als Organ der Rechtspflege ist es seine Aufgabe, das beste für die Mandantin herauszuholen. Ich denke, dass er das versucht, und dabei zugleich bestmöglich aussehen will. Je nachdem, wen er vertritt, sind seine Äußerungen dann höchst unterschiedlich. Soweit erwartbar. Er ist ein Star unter den Anwälten der Stars.
Wen es interessiert:
Hier auf LTO äussert Herr Fischer seine Perspektive auf die Doku:
https://www.lto.de/recht/feuilleton/f/ard-doku-staranwalt-christian-schertz-thomas-fischer-rezension/?utm_source=pocket-newtab-de-de
Daraus das Zitat:
……“Und Herr Niggemeier von Übermedien, der in drei Sätzen über Schertz mehr sagt als der Autorinnenkommentar im ganzen Film.“