Der Autor
Stefan Schulz hat – gefördert durch den verstorbenen Herausgeber Frank Schirrmacher – zwischen 2011 und 2014 für die FAZ gearbeitet. Er hat ein Buch über den Umbruch in der Medienwelt geschrieben: „Redaktionsschluss“.

Manchmal störte es, meistens wäre ich gern dabei gewesen, wenn Gerhard Stadelmaiers Lachen durch den Feuilleton-Flur donnerte. Worum es ging, erfuhr man nicht. Aber die Szenerie war häufig dieselbe. Die Büronachbarn Gerhard Stadelmaier und Dietmar Dath verstrickten sich auf ihrem nur etwa drei Meter langen Weg von der Redaktionskonferenz zum Schreibtisch so tief im Anekdotenspektakel, dass sie die restliche Vormittagszeit brauchten, sich hinter halb geschlossener Tür wieder zu entwirren. Das Lachen verriet nur den tiefschwarzen Humor zweier brillanter Köpfe. Hätte man die Szenen dokumentiert und verlegt, müsste man sich um die Zukunft der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ wohl nicht sorgen. Aber die Zeitungen behalten das Beste immer für sich.
Stefan Schulz hat – gefördert durch den verstorbenen Herausgeber Frank Schirrmacher – zwischen 2011 und 2014 für die FAZ gearbeitet. Er hat ein Buch über den Umbruch in der Medienwelt geschrieben: „Redaktionsschluss“.
Man kann seit heute nachlesen, aus welchem Fundus Stadelmaier da schöpfte. Der gefürchtete, wortgewaltige Theaterkritiker der FAZ, frisch in Rente, erinnert sich mittels eines Romans zurück und gestaltet seine Geschichte als eine „des jungen Mannes“ in drei Akten. Sie beginnen immer gleich, mit Chefredakteuren, die dann doch keine sind und die sterben oder anders abtreten. Es wird recht viel gestorben, vor Straßenbahnen, unter Autos oder in Höchstgeschwindigkeit an Bäumen. Auf der ersten Seite, und eigentlich nur da, wird die Temperatur noch mit einer Portion Sex angehoben. Es wird „ausgekeucht“ und „ausgejauchzt“ und „Balsam“ an „wunde Stellen“ gegeben. Die Protagonisten sind in voller Fahrt, und wir Leser finden uns in derselben Rolle wieder wie die zuhörenden Bewohner „in der kleinen Stadt“. Wir bitten um Ruhe („Psssst!“) und harren der Dinge. 220 Seiten Zeitungsgeschichte sind zu absolvieren.
Der Plot ist wie gewohnt nebensächlich. Nicht einmal mit der Nennung von Namen will uns der Autor von seinen Impressionen ablenken. Und doch erfahren wir in fast lehrbuchartiger Weise etwas darüber, wie Zeitungen funktionieren, sich verändern und wie eben einer ihrer berühmten Macher sich den Weg zum „Königsthron der deutschen Theaterkritik“ bahnte. Das steht nämlich außer Frage: Das „Geheimnis der Szene“ und das „Wunder der Schauspieler“, die „Schreckensabgrundschätze“ des Theaters, um die geht es hier. Zeitungen sind da eher Vehikel, für das „Hochamt der Rezension“, die „Hauptsache des Feuilletons“, kurz, den „Wörtergottesdienst“, der eben nur auf Papier gedruckt und über Nacht zu den Leuten verschickt abgehalten werden kann. (Wir können das Zitate-Feuerwerk der Sprachschöpfungen an dieser Stelle übrigens gefahrlos abbrennen ohne zu viel zu verraten. Wer sich für Stadelmaiers einzigartige Sprache nur als Dekoration interessiert, liest schon seit Jahren das Stadelmaier-Tumblr, das seine „sprachlichen Preziosen“ sammelt.)
Es geht also um mehr, nämlich um Antwort auf die Frage, wie all das möglich wurde. Nun, ganz schlicht, der junge Mann bewarb sich. In einer alten ehemaligen Metallwarenfabrik residierte die Redaktion der „Stadtpost“. Er stieg die alte Holztreppe „in eine Art Olymp hinauf“ und stürzte sich in den produktiven „Rätselspielplatz“, in dessen tägliches Zeitungsergebnis sich die Leser „hineinträumen, hineinverlieben und hineinsteigern“ sollten.
Angespitzt und andeutungsvoll, wie er schreiben wollte, bot sich zwischen den Zeilen viel Platz für jemanden wie ihn. „Da es sonst wenig an Bildern zu sehen oder zu glotzen gab, war es eine gewaltige Zeit fürs Lesen.“ Der tägliche Umbruch – also der Produktionsschritt der Zeitung aus der Redaktion heraus in die Druckerei hinein – „umbrach die Stadt“, schreibt Stadelmaier. Es waren glückliche, heute verlorene Zeiten. Nicht einmal in den Tiefen der „Zeitvergegenwärtigungstäuschungsmaschine, die sich Internet nennt“, lassen sich noch Spuren dieser Geschichte finden.
Hier entstand, angetrieben von frühen Theaterbesuchen mit den Eltern, der Traum vom mitzaubernden Zuschauer, mit dem in Aufführungen fest zu rechnen sei, der mit im Programmheft steht und über den das Ensemble da oben ebenso staunt, wie er ihr Spiel von unten bewundert. „Parkett, Reihe 6“, der Autor hat seine Leidenschaft bereits an anderen Büchern dokumentiert. An dieser frühen Stelle bot ihm die „Stadtpost“ jedoch nur den Traum. „Das Theater. Eine Möglichkeit. Über die man schreiben und die man beschreiben kann“, das lag der Provinz fern. Berichte und Reportagen, ja. Aber wozu Hymnen und Verrisse?
Als sich der junge Mann den ersten Ausflug ins unbekannte Genre zutraute, standen danach die Stadt und die eigene Familie Kopf. Jemand, der sich schon lange wagen wollte, statt nur Beifall zu spenden, auch mal „Bin ich froh, dass der Scheiß vorbei ist!“ zu rufen, hatte sich tatsächlich an der örtlichen Prominenz abgearbeitet. Es war ein nicht gänzlich gescheitertes Experiment.
Der junge Mann ging danach nicht länger zur Arbeit, er pilgerte hin. Und er wechselte die Adresse. Er tauschte die ehemalige Metallwarenfabrik im Ort gegen ein Zeitungshaus in der Landeshauptstadt, das jederzeit – und vielleicht sogar besser – zur Herstellung von Sauerkraut und Schrauben genutzt werden konnte. Das Damoklesschwert senkte sich leicht, als dort auch noch Computer Einzug hielten.
Die sakrale Überhöhung seines Berufs ist dem Autor Stadelmaier nicht fremd. Hier spricht er von „einer Art säkularer Gottesdienstgemeinde“, die als „wundersame Gemeinschaft der Lebenden und Toten“ geschichtsverträumt und von der Welt abgeriegelt Blatt macht und plötzlich im Keller tatsächlich auf Knien zu beten anfängt. Der Grund war profan: Die „Stuttgarter Zeitung“ – um die es hier geht – führte als eine der ersten in Europa den elektrischen Produktionsbetrieb ein. Er klappte nicht immer. Umbruch war 18 Uhr, doch manchmal war die Maschine einfach stumm geblieben und die Redakteure um Mitternacht aller anderen Handlungsmöglichkeiten als dem Gebet beraubt.
Der Spuk begann. Die Zeitung, berühmt dafür, den Sputnik-Schock schlicht verpasst zu haben, weil der Nachtdienst der Politikredaktion mal wieder „im Brauhaus erledigt“ wurde, befasste sich nun mit Technologie und obendrein mit ihren Lesern. Diese galten – nach „allergesundester Meinung“ mancher Redakteure – nicht länger als „dumm und frech“, sondern nun auch als gefährlich. Damals kam der Chef von einer weiten Reise zurück und berichtete, er habe gehört, dass es die Kundschaft der Zeitung dahinraffen könnte, wenn sie in einen neuen „Verflüssigungsraum“ abwandert, wo sie selbst zum Stift greifen könnte und kein Papier mehr bräuchte, weil sie sich mit „elektronischer Technik über Bildschirme vernetzt“. Eine Seite widmet Stadelmaier dieser Problemstellung. Auf der nächsten legt er der Filmkritik-Kollegin von damals noch das Wort „Verflüssigungsdingsbums“ in den Mund. Noch ein paar Zeilen später bleibt dann von dieser Internetvorahnung nur ein „Sumpf“.
Medienumbruch bedeutet in Stadelmaiers Geschichte, die – so viel Biografie hat er auf dem Buchdeckel versprochen – immerhin 37 Jahre in Redaktionen überspannt, dass Setzer von „Tippsen“ ersetzt werden, manchmal „kleine Hospitanten“ in den Redaktionen herumstehen und berufsfremdes Personal die Maschinen im Keller in Ordnung hält. Interessiert an den großen Dramen (zum Beispiel nachwirkend Kennedys Tod, Willy Brandt oder die Deutsche Einheit), wird es nur ein Mal für Stadelmaier existenziell. Der Terror der RAF warf seinerzeit Gesinnungsfragen auf, auch in den Redaktionen. Im „Zeitungsparadies“ war neuerdings die Frage zulässig, ob es etwas „Wichtigeres als Kunst“ gebe. Die „extraterritoriale Arroganz“ in der Redaktion wich einem „Nicht-Ewigkeitsgefühl im Feuilleton“. Und die Ökonomie hielt Einzug: „Schreiben über Kleist?“ Warum nicht lieber über Kölner Möbelmessen? „Mehr Service, weniger Kritik“, „Daumen hoch! oder Daumen runter!“. Plötzlich, vor Jahrzehnten, wurden Sprüche und Haltungen alltäglich, deren Ursprung heute aus Verlegenheit Facebook in die Schuhe geschoben werden.
Rezensionen wurden „zähneknirschend geduldete Überflüssigkeit“, oder, wie Stadelmaier es nach typisch unendlich vielen Halbsätzen in einem extra reservierten Satz schreibt: „Das Allerheiligste hatte da einen schweren Stand.“ Die Redakteure bekamen Angst, und reduzierten sich auf „Papierexistenzen“. Für eine kleine Kostenersparnis wurde aufs Spiel gesetzt, was zuvor noch den Krieg überstand. Konferenzthema war nicht länger die „schönste, zarteste, unvergesslichste Inszenierung“, sondern „Sein oder Nicht-Sein des Ressorts“. An dieser Stelle jedoch, als Gerhard Stadelmaier ernst wird und von Floskeln ablässt, um darüber zu schreiben, was war, bricht der Text um – oder eigentlich ab.
Als wäre seine Arbeitszeit abgelaufen oder das Papier zu Ende, bleibt von Stadelmaiers Zeit bei der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ nichts im Buch, außer der Vertröstung, es handele sich bei ihr sowieso „um eine andere Geschichte“. Die 26 Jahre auf dem Olymp bleiben fast unbeschrieben. Gerade noch ein Ausflug zum Buchmessenempfang der FAZ 1993 wird dem Leser gegönnt, um gemeinsam mit dem jungen Mann noch einmal den damaligen Feuilleton-Herausgeber Joachim Fest – den „vornehmen Allgewaltigen“, „Gentlemen-Führer“, „Herr“ und „König“ – zu verabschieden.
Und Frank Schirrmacher, der andere Allgewaltige? Der wird von Stadelmaier in zwei Sätzen abgehandelt, die aus dem Roman ein biografisches Sachbuch machen. Im einen ist Schirrmacher ein, „wie boshaft geraunt und gemunkelt wurde, offenbar etwas fragwürdig promovierter Möchtegern-Nachfolger“ Fests. Und im anderen gilt er Stadelmaier als sein Sklavenhalter.
Nun, der so Verunglimpfte kann sich dagegen nicht mehr wehren. Und ehrlich gesagt muss sich in diese späte Abrechnung niemand einmischen. Aber was lernen wir am Ende des Buchs? Hatte der „junge Mann“, der jetzt ein älterer ist, eine Botschaft für heute junge Frauen und Männer, die einem wie ihm bewundernd nachstreben? Nein, der Roman ist ein Roman, und „Romane enthalten keine Argumente“, schrieb der aktuelle Allgewaltige des Feuilletons erst dieser Tage.
Ich kann also nur eine bei mir als Leser – und Stadelmaier-Bewunderer – aufgekommene kleine Lehre anhängen. Wäre es doch nur irgendwie gelungen, Stadelmaier den bockigen Sinn auszutreiben, zwei Jahrzehnte „für Theater und sonst nichts angestellt“ zu sein. Die große Staatszeitung hätte heute ein Gespür für die Kreativität der kleinen Kunst und für die Kraft der freien Theaterszene. Und es hätte heute mehr Sinn, „kleine Hospitanten“ in die Zeitungen zu holen, die dort nämlich nicht nur Quartalsbilanzberichterstattungen abliefern, sondern auch mal im Theater mitträumen und darüber schreiben wollen.
Aber Stadelmaiers Tür stand immer nur so weit offen, dass alle mitbekamen, wie viel Spaß er bei der Arbeit hatte. In allen anderen Momenten blieb sie fest verschlossen.
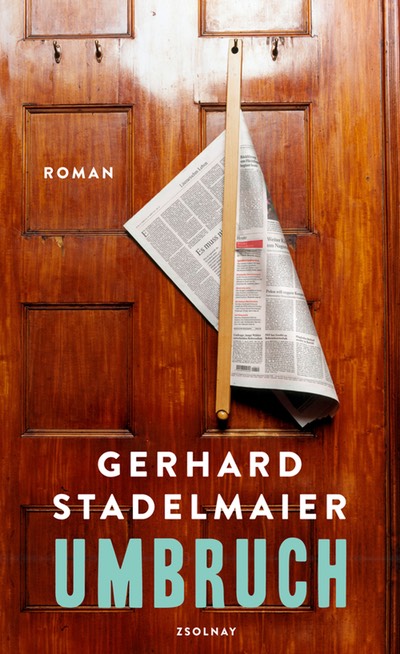
Gerhard Stadelmaier
Umbruch
Zsolnay-Verlag
22 Euro
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
Ich lasse ja gerne anderen ihren Spaß, aber vielleicht kann ich ja zu einem Meinungsbild beitragen: Mir tut ihr mit solcherlei Feuilletonbeiträgen (Ich weiß nicht, wie ich den Stil treffender beschreiben könnte, ohne unnötig ausführlich zu werden.) keinen Gefallen, und ich würde mich freuen, wenn es kein Trend wäre.
Ich sag’s nur.
Interessanter Text mit treffsicherem Schluss. Die zwei letzten Sätze sind sehr gut formuliert!
Ich mag Feuilletonbeiträge. Kommentare von Muriel nicht, die sind von zu vernachlässigender Relevanz.
Ich sags ja nur.