Mehr über ARD-Mediathek
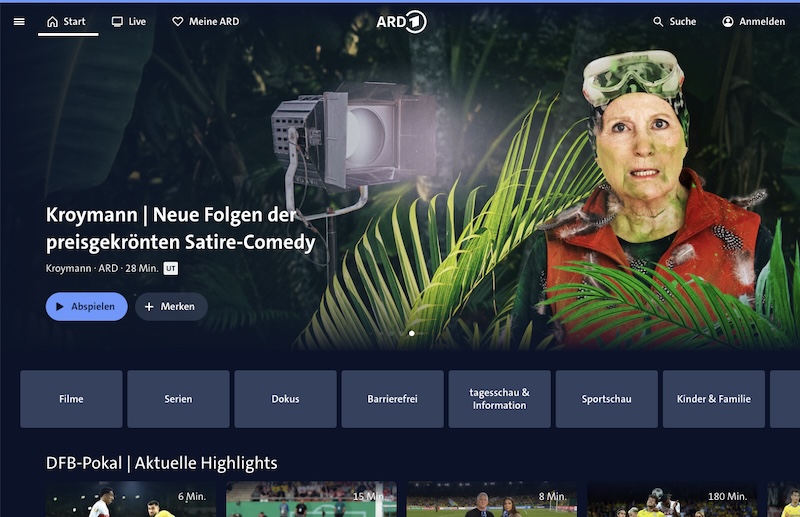

Wo könnte man Werte wie Bodenständigkeit besser lernen als beim Pferdestall-Ausmisten im Sauerland? Dort jedenfalls hat Sebastian Steinau seine Bodenständigkeit her. Und die ist offenbar hilfreich, wenn man in New York lebt und Luxuswohnungen verkauft. Warum genau, wird in der „Doku“ über den erfolgreichen High-End-Immobilienmakler, die in der ARD-Mediathek zu sehen ist, zwar nicht ganz klar – aber egal. Steinau erzählt es einfach, es klingt irgendwie gut. Und es passt perfekt zu seinem Image: der „diskrete, bodenständige“ Deutsche, der jetzt im Big Apple sein Big Business macht.
Damit ist Steinau die Idealbesetzung für das ARD-Format „Money Maker“. Die Serie erzählt laut Selbstbeschreibung „faszinierende Geschichten“ über Menschen, die „mit teils genialen Ideen und dem unerschütterlichen Willen zum Erfolg ihren Traum leben“. Über 20 Folgen gibt es mittlerweile – zu sehen ausschließlich in der Mediathek.
„Money Maker“ ist eine Gemeinschaftsproduktion der „plusminus“-Redaktionen der ARD. Deshalb ist die Reihe im weitesten Sinne als Wirtschaftsberichterstattung zu sehen. Der Auswahl der Protagonisten nach zu urteilen, richtet sich die Reihe vor allem an jüngere Menschen. Es sind oft Influencer, Gamer und Youtuber, die man aus sozialen Medien kennt.
Das Format steht damit für ein trendiges Genre, das vor allem von Streamingdiensten wie Netflix entwickelt wurde und längst auch in öffentlich-rechtlichen Produktionen angekommen ist: die Pseudo-Doku. Denn mit einer Dokumentation im journalistischen Wortsinne haben diese Formate nicht mehr viel zu tun. Zwar bemühen die Macher gerne das Label „authentisch“ und „hautnah“, letztlich handelt es sich dabei aber oft nur um freundliche Umschreibungen für unkritisch und distanzlos. Kein Wunder, dass mittlerweile jeder halbwegs Prominente „seine eigene Doku“ zu haben scheint, in der er sich zum eigenen PR-Zweck ganz nahbar geben darf: von David Beckham und Joshua Kimmich über Max Herre und Joy Denalane bis hin zu den „Money Makern“.
Viele der Porträtierten sprechen in „Money Maker“ offen über ihr Geld – etwas, das bei sehr wohlhabenden Menschen sonst eher selten vorkommt. Wahrscheinlich liegt das auch daran, dass es sich bei den Filmen um gefällige Wohlfühlporträts handelt. Die porträtierten Unternehmer erhalten viel Raum und müssen kaum fürchten, dass sich jemand kritisch mit ihnen oder ihrem Geschäftsmodell auseinandersetzt (bis auf ein paar Ausnahmen). Dass einige Protagonisten den Trailer zur „Doku“ auf ihren Social-Media-Kanälen posten und sich begeistert über „ihre eigene ARD Doku“ freuen, ist nur ein Beleg dafür.
Auch Sebastian Steinau teilte den Trailer zu seiner Doku stolz auf seinem Kanal. Dem bodenständigen Immobilienmakler darf man im Film dabei zusehen, wie er seine Kinder von der Schule abholt, mit ihnen Austern einkauft und die Meerestiere anschließend mit seiner Frau auf der Dachterrasse mit Blick auf den Central Park schlürft. Er spricht von „Transaktionen“, „Opportunitäten“ und „Segmenten“, erklärt, dass Erfolg „toll“ und „sexy“ sei, und wie „schön“ es sei, wenn Nachbarschaften sich „verändern“, „vibrieren“ und „nach oben kommen“.
Vielen Zuschauern dürfte an dieser Stelle schon klar werden: Es geht hier um Wohnraum, den sich normale Menschen schon lange nicht mehr leisten können. Doch genau diese Szenen offenbaren auch die Schwächen von Filmen ohne Kommentar, also ohne Off-Sprecher, der Dinge einordnet und erklärt. Die einzige Gegenrede der Reporterin hinter der Kamera („Dafür können es sich nur wenige leisten.“) setzt keinen wirklichen Kontrast. Und die eingestreuten Bilder von namenlosen Obdachlosen wirken in ihrer Ästhetik eher wie hippe Streetfotografie denn wie ernsthafte Kritik an den Bedingungen, unter denen der Porträtierte sehr viel Geld verdient.
Anderen Protagonisten rollt „Money Maker“ sogar den Werbeteppich aus. Im Film über „Snocks“-Gründer Johannes Kliesch fliegen schon im Vorspann die Unterhosen und Socken seiner Marke effektvoll beleuchtet und in Zeitlupe durch die Luft – und der sympathische Unternehmer darf seine Erfolgsstory erzählen. Fußball-Influencer Michael Bolvin referiert ausführlich über die Torwarthandschuhe, die er entwickelt hat und verkauft. Sie hätten wegen ihrer „rutschfesten Latexschicht“ einen „besonderen Grip“. Er wolle die „beste Torwarthandschuhmarke der Welt“ aufbauen, sagt er.

Die Geschäfte von Bolvin scheinen jedenfalls gut zu laufen. So gut, dass er sich bereits zwei Wohnungen in Dubai kaufen konnte. Dass ein reicher Influencer wie Bolvin möglicherweise nicht nur wegen der Aussicht über Dubais atemberaubende Skyline in das Emirat ziehen will, sondern vielleicht auch, weil man dort kaum Steuern zahlen muss, erfährt der Zuschauer selbstverständlich nicht.
Viele der Lebensgeschichten, die in „Money Maker“ erzählt werden, sind durchaus beeindruckend. Unter den Protagonisten finden sich nicht nur Unternehmersöhne wie der eingangs erwähnte Sebastian Steinau, sondern auch auffallend viele Menschen mit migrantischer Biografie. Im Kern erzählt die Reihe jedoch immer wieder dieselbe Geschichte: die deutsche Variante vom Tellerwäscher zum Millionär.
Allen Porträtierten gemein sind ein ausgeprägtes Arbeitsethos und zweifellos auch Mut. Doch den überwiegend jungen Zuschauern wird hier ein unrealistisches Bild von der Möglichkeit vermittelt, reich und erfolgreich zu werden. Denn auch wenn man sich anstrengt und „sein Ding macht“, ist es am Ende wahrscheinlicher, für Unternehmer wie die Porträtierten zu arbeiten oder ihre Produkte zu kaufen, als selbst zu diesem exklusiven Kreis zu gehören.
Von einigen Protagonisten ist auch zu hören, dass Geld ihnen ja nicht alles bedeute. Eine romantische Position, die sie sich leisten können. Weil sie Geld haben. Das Format hinterfragt das kaum. Dass zum Beispiel die „Shisha-Boys“, zwei Brüder, die in Wien mit Gastronomie und anderen Unternehmungen reich geworden sind, nun auf Mallorca ein neues, einfacheres Leben mit Kunst und Musik führen, weil sie „im privaten Bereich wachsen“ wollen und nicht mehr im „unternehmerischen“, könnte vermutlich auch daran liegen, dass sie schlicht nicht mehr arbeiten müssen, weil ihr Vermögen für sie arbeitet.

Ein journalistisches Format muss so etwas nicht immer bis ins kleinste Detail erklären, sollte es aber auch nicht völlig ignorieren. Vor allem dann nicht, wenn es eine sehr junge Zielgruppe anspricht, die schon täglich in den sozialen Medien in die unrealistische und kapitalistische Welt der Influencer blickt. Tatsächlich ist der Kapitalismus der eigentliche Star dieser Reihe, deren Folgen Titel tragen wie „Superreich mit Online-Shops“, „Vom Insta-Star zum Yacht-King“ oder „Millionen mit OnlyFans“.

Es gibt jedoch auch Ausnahmen: Eine Folge porträtiert Serkan Eren, den Gründer der Hilfsorganisation Stelp. Er gilt als „Money Maker“, weil er Spenden für Kriegs- und Katastrophengebiete sammelt. Die jüngste Episode mit dem Titel „Reich durch Ballermann-Musik“ richtet den Blick auf die Schlagersängerin Isi Glück. Vordergründig geht es auch hier um ihren wirtschaftlichen Erfolg und ihr Leben auf Mallorca.
Dabei zeigt sich aber, dass die Produktion auch mehr bieten kann. Zwar stellt sie auch diese Protagonistin sehr positiv dar, eröffnet aber zugleich einen Einblick in den Partyschlager als Wirtschaftsfaktor, macht zumindest subtil sichtbar, wie sexistisch das Geschäft teilweise ist, und man erfährt sogar, inweifern die Harmonik von Ballermann-Hits der von Bach-Stücken ähnelt.
Wirklich kritische Einordnung gibt es bei „Money Maker“ aber nur dann, wenn Geschäftsmodelle allzu offensichtlich dubios erscheinen. Etwa bei dem Unternehmer, der „legales LSD“ verkauft – also chemische Verbindungen, die gerade nicht unter das gesetzliche Verbot fallen. Hier dürfen ein Kripobeamter und ein Toxikologe ausführlich zu Wort kommen. Doch auch der berufsmäßige Drogenhändler wirkt hier am Ende eher wie ein cleverer Typ.
Ähnlich bei Dennis Loos, der durch sogenanntes Multi-Level-Marketing zum Multimillionär geworden ist. Ihm wird immerhin eine kritische Professorin für Unternehmensethik gegenübergestellt, die erklärt, dass nur wenige von diesem System profitieren. Ob Loos tatsächlich nicht zu den „schwarzen Schafen“ der Branche gehört, wie er behauptet, will der Film offenbar gar nicht herausfinden – man muss es Loos schlicht glauben.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
Dazu jetzt ein richtig linker, sozialistischer Kommentar.
Ich persönlich finde solches zur Schau stellen ja schon ziemlich abstoßend, vor allem wenn es in Kombination mit „ich wohne jetzt in Dubai oder anderen Steueroasen“ stattfindet.
Es wird einem ja oft Neid vorgeworfen bei solch einer Meinung aber ich finde es schon sehr unsozial sich an der Gesellschaft zu bereichern und dann sein bestes zu geben möglichst wenig über Steuern zurückzugeben. Und dann ja auch oft noch in Unrechtsstaaten wie Dubai.
Und dieses sich anbiedern an „Geld ist geil – auch du kannst es schaffen Leute“ am besten noch mit dem Ammenmärchen vom Tellerwäscher zum Millionär, ist echt eklig.
Ich wäre mal für ein Format das all die portraitiert die auf diese Masche reingefallen sind, es aber nicht geschafft haben. Die sich verkauft und/oder kaputt gearbeitet haben und am Ende mit wenig dastehen. Die, die ihr Leben und oft Freundschaften geopfert haben und vom Raubtier-Kapitalismus gefressen und wieder ausgespuckt wurden.
Denn durch die sozialen Medien, die die Grenze verwischen zwischen Internet“Stars“ und persönlichen Freunden scheint so etwas ja noch viel eher erreichbar für die junge Generation als jemals zuvor.
Ich gehöre eindeutig nicht zur Zielgruppe für diese Sorte Reichtumsporno. Selbst wenn mir jemand einen Lastwagen voller Geld vor die Tür stellen würde, käme ich nicht im Traum auf die Idee, nach Dubai zu ziehen oder mir einen Ferrari zu kaufen.
Aber diese Darstellung von „Es geschafft haben“ ist nicht das Problem an solchen Reihen – das Problem ist die Behauptung, alle könnten es schaffen, wenn sie sich nur ein bisschen anstrengten und gute Ideen hätten. Tatsächlich kann es jeder>/i> schaffen (theoretisch), aber niemals alle (praktisch). Der Kapitalismus braucht halt viel mehr Arbeiterinnen und Friseure und Paketboten als StartUp-Millionäre.
Insofern vermitteln solche Sendungen oberflächlich eine Haben-wollen-Faszination, untergründig aber einen absurden Vorwurf: Wenn Du es nicht geschafft hast, liegt das an persönlichem Versagen. Hässlich.
Argh, HTML-Chaos. Sorry. Der Satz sollte lauten:
Tatsächlich kann es jeder schaffen (theoretisch), aber niemals alle (praktisch).
Also ich kann jetzt der Kritik im Artikel und in den Kommentaren nur wenig abgewinnen. Das sind doch keine „Reichtum ist geil“-Filmchen, sondern welche über unternehmerischen Erfolg. Dagegen jetzt Dokus zu fordern, die Abgestürzte und Ausgestoßene des Arbeitsmarkts portraitiert, find ich dann doch bissi billig.
Dass man unternehmerisch (und als Selbstständiger) in völlig unterschiedlichen Branchen Erfolg haben kann, ist doch an sich ein nettes Sujet für ein Videoformat mit junger Zielgruppe. Bisschen gute Laune schadet bei dem Thema auch nicht (werblich wie bei den Socken ist aber schon ein Ausrutscher).
Bei aller Sympathie für sozialistische Gesellschaften, aber wir leben nicht in so einer. Und nicht jede Doku über Wirtschaft muss den Kapitalismus kritisieren. Dass LUXUSwohnungen in dieser Welt nur was für Reiche sind, ist dem Zuschauer auch so klar.
Zu #4
In der heutigen „Social Media Welt“ sind ungesunde parasoziale Beziehungen sehr viel häufiger anzutreffen als noch zu TV Zeiten. Das zeigt auch das buhlen um Influencer als Werbefiguren. Da verschwimmen Grenzen von realer und einseitiger Freundschaft. Und wenn der „Freund“ es schafft kann ich es ja auch schaffen.
Die Jugend von heute und der letzten ca 10 Jahre hat eine radikal andere Lebensrealität als früher. Argumente wie „Dass LUXUSwohnungen in dieser Welt nur was für Reiche sind, ist dem Zuschauer auch so klar.“ passen vielleicht zu älteren Semestern, für die sind diese Filmchen aber wohl eher nicht gemacht.
Und ich möchte auch nicht alle Jugendlichen über einen Kamm scheren, auch da gibt es einige die eine gute Erziehung hatten (damit ist gemeint gut für das Kind). Aber ein nicht gerade kleiner Teil wird eher von sozialen Medien großgezogen als von Eltern die erklären und einordnen können.
Und wozu braucht es noch diese Filmchen, deren Geschichte erzählen die doch selbst schon, schön inszeniert und absolut kritikfrei auf Youtube, Insta und TikTok.
Das ganze jetzt noch von Öffentlich Rechtlichen nachzuplappern, nochmals auf Hochglanz getrimmt und mit ordentlich Pathos als „Doku“ präsentiert ohne kritische Einordnungen und Fragen finde ich schon problematisch.
Ein bisschen Realitätsflucht ist ja auch gesund. Aber in einer Welt in der das soziale Miteinander seit Jahren auf Talfahrt ist, massenhaft Menschen trotz harter Arbeit sich keine Wohnung leisten können, in der die Schere zwischen arm und reich immer weiter auseinander geht da steigt die Angst und der Traum vom Insta-Star wird noch erstrebenswerter.
Es würde mich auch nicht so sehr stören wenn das Web nicht schon voll wäre von Insta Self Made Millonären die ihre Kohle über Steuroasen verstecken.
„Und nicht jede Doku über Wirtschaft muss den Kapitalismus kritisieren.“
Wenn bestimmte Lebensweisen deutliche Auswirkungen auf andere Menschen haben dann sollte das benannt werden.
Menschen die Bürgergeld beziehen werden teils als das asozialste Pack hingestellt das es gibt, ca 0,4% Totalverweigerer als eines der größten Übel für unseren Sozialstaat.
Aber jene „Steuervermeider“ bekommen unkritische Portraits.
„Bei aller Sympathie für sozialistische Gesellschaften, aber wir leben nicht in so einer.“
Dazu zitiere ich Artikel 20 des Grundgesetzes: „Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.“ Denn das soziale steht nicht im Widerspruch zum Kapitalismus.
Und ich kritisiere hier nicht den Kapitalismus sondern den Missbrauch desselbigen. Dazu ein Zitat von Marcel Fratzscher:
„Es ist der Missbrauch von Kapitalismus und Demokratie, der dem im Wege steht. In einer vom Neoliberalismus geprägten Wirtschaftspolitik der letzten 30 Jahre ist es einigen wenigen gelungen, den marktwirtschaftlichen Wettbewerb in ihrem Sinne zu verzerren und demokratische Institutionen zu manipulieren. Auch in den Demokratien werden Gesetze, Steuern und Finanzpolitik so umgestaltet, dass sie zu einer massiven Umverteilung von unten nach oben geführt haben, mit immer extremeren Ungleichheiten bei Vermögen und auch Freiheiten. Die mächtigen Wirtschaftsinteressen missbrauchen den Staat in einer Art Vollkasko-Mentalität – Gewinne werden privatisiert, Verluste und Risiken sozialisiert.“
„Dagegen jetzt Dokus zu fordern, die Abgestürzte und Ausgestoßene des Arbeitsmarkts portraitiert, find ich dann doch bissi billig.“
Was ist daran billig? Die meisten Leute wollen es halt nicht sehen. Aus den Augen aus dem Sinn. Wie die regelmäßigen Versuche Obdachlose, Bettler und Pfandflaschen-Sammler aus Innenstädten rauszubekommen.
Fazit:
Von mir aus sollen die solches Zeug senden aber von Öffentlich Rechtlichen Sendern erwarte ich etwas mehr Distanz und Kritik.
Ich hoffe ich bin hier nicht zu sehr offTopic gegangen. Aber mMn ist das ganze zu komplex als das hier ein kurzer Kommentar gereicht hätte.
Ob der „bodenständige“ Immobilienmakler seinen Kindern auf der Dachterrasse am Central Park dann auch erklärt, warum der Kapitalismus, besonders in den USA, soziale Ungleichheiten immer größer macht und den Planeten zerstört, sodass Austern bald unser kleinstes Problem sind? Aber hey, nicht schon wieder linksgrüner Moralismus – have fun!
Im Multi-Level-Marketing gibt es letztlich keine weißen Schafe. Sie sind alle Pyramidensysteme.
Die Struktur lässt es nicht anders zu, dass selbst der seltene Erfolg einer kleinen Spitzengruppe auf der Ausbeutung aller anderen darunter beruht – einschließlich permanenter Manipulation und dem angesprochenen „du bist selbst schuld, wenn du es nicht schaffst“. Viele MLMs nehmen sektenartige Züge an.
Das ist ein sehr weites Feld, zu dem besonders viele YouTuber aus den USA und Kanada sehr unterhaltsame und entlarvende Inhalte produzieren. Man kann nicht einfach mehr oder weniger naiv über so ein Geschäftsmodell berichten und offen lassen, dass es sicher auch gute Varianten geben wird.
Für mich hatte sich das Format nach dieser Folge erledigt. Wann immer ich neue Folgen in der Mediathek sah, haben mich schon Titel oder Thumbnail abgeschreckt.
Dabei haben auch ARD und ZDF schon sehr schöne Beiträge dazu produziert. Zum Beispiel in „7 Tage bei Staubsauger-Vertretern“ (oder so ähnlich). Auch hier wird zwei vermeintlichen „Money Makern“ gefolgt, doch selbst ohne Experten kommt die Kritik durch den Reporter und andere Protagonisten ganz elegant und unaufgeregt rüber.
„Und nicht jede Doku über Wirtschaft muss den Kapitalismus kritisieren.“
Das mag stimmen – aber bei diesen sogenannten „scripted Documentaries“ handelt es sich ja im Grunde um eine contradictio in adiecto.
Ich kenne zufällig zwei Personen, die in einer der Folgen vorkommen, wenn auch nur flüchtig. Der Protagonist ist einer von ihnen – er war bereits zuvor als „self-made entrepreneur“ in einem eher yellow-press-artigen TV-Format zu sehen. Ein sympathischer, einnehmender Mensch, keine Frage. Aber der massive Einsatz von Weichzeichnern im Storyboard ist, imho, schon auffällig.
Und selbstverständlich erfüllen diese Geschichten eine Funktion: Die Erzählungen vom möglichen Aufstieg gehören – ebenso wie die vom drohenden Absturz – zum Legitimationskonzept unserer Gesellschaft.
Den „da unten“ muss es schlecht gehen, damit ich alles daransetze, nicht irgendwann einer von ihnen zu sein.
Aber es muss auch die Tellerwäscher-Aufstiegsgeschichte geben, damit ich das System nicht infrage stelle.
Jeder kann es schaffen – so wie auch jeder im Lotto gewinnen kann.
Das Märchen von der Meritokratie.
Was mich wirklich stört, ist, dass diese Formate nie mitgezählt werden, wenn es um die politische Einordnung der Sendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geht.
Menschen, die sich informative Formate wirklich ernsthaft aneignen, sind doch klar in der Minderheit gegenüber jenen, die dieses seichte „Infotainment“ konsumieren.
Also verliert die Evidenz gegen die Erzählung.
„Mietnomaden“ sind dann das eigentliche Problem – nicht etwa gierige Immobilienkonzerne, die ganze Tranchen aufkaufen und brachliegen lassen, um die Preise zu treiben.
Kriminalitätsexplosionen werden, entgegen allen Zahlen, eben gefühlt statt erlebt.
Und wohin das alles führt, sehen wir in den USA.