Der Autor

Johannes Franzen ist Literaturwissenschaftler an der Universität Bonn. Außerdem schreibt er kulturjournalistische Texte und ist Redakteur bei 54books. 2018 erschien sein Buch „Indiskrete Fiktionen“ im Wallstein Verlag.
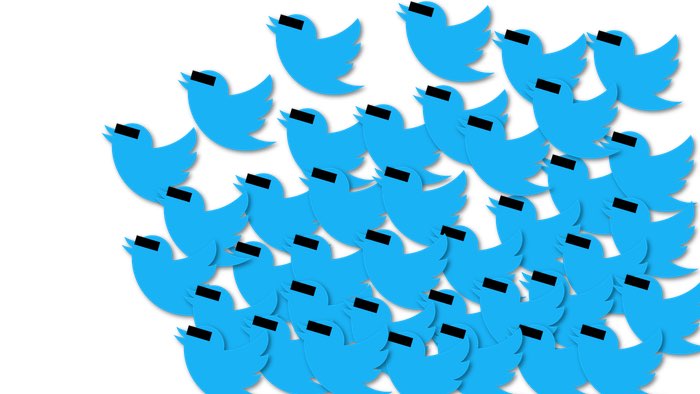
Zu den festen Größen im Angsthaushalt der digitalen Gegenwart gehört der Twittermob. Dieser Mob, eine amorphe, anonyme Masse dauerempörter Menschen, die gnadenlos über jeden herfällt, der sich auch nur der kleinsten Verfehlung schuldig gemacht hat, ist eine beliebte Figur in der Schauerromantik zeitgenössischer Kulturkritik. Wenige Dinge bringen die Angstlust der Kommentatoren stärker in Wallung. Der Philosoph Markus Gabriel etwa sagte unlängst in einem Interview:
„Die ‚Bild‘-Zeitung ist fatal, aber weit weniger fatal als Twitter. Wenn die ‚Bild‘-Zeitung verschwindet, habe ich nichts dagegen, aber ich möchte noch lieber, dass Twitter verschwindet. Vor Twitter habe ich ernsthaft Angst.“
Schlimmer als „Bild“ also: eine durch Algorithmen aufgepeitschte Menge, die politisches Engagement nur simuliert und dabei großen Schaden im Diskurs anrichtet.

Johannes Franzen ist Literaturwissenschaftler an der Universität Bonn. Außerdem schreibt er kulturjournalistische Texte und ist Redakteur bei 54books. 2018 erschien sein Buch „Indiskrete Fiktionen“ im Wallstein Verlag.
Diese durchaus repräsentative Art des Schreibens und Redens über Twitter – maximal alarmistisch und minimal konkret – hat Folgen. Wenn ich Kolleg*innen und Freund*innen zu vermitteln versuche, warum es sich lohnen würde, auf Twitter aktiv zu sein, dann zeigt sich regelmäßig eine vage Angst davor, dort zum Opfer einer brodelnden diskursiven Aggression zu werden. Wenn man ständig in der Zeitung liest, dass auf Twitter der Mob umgeht, dann erscheint die Angst davor, dort selbst an den Pranger gestellt zu werden, gar nicht mal so unwahrscheinlich. Es ist deswegen schwer zu vermitteln, dass es extrem unterschiedliche Möglichkeiten gibt, diese mediale Infrastruktur zu nutzen.
Twitter ist, wie die meisten Orte des medialen Austauschs, weder Utopie noch Horrorshow. Und auch wenn das zuweilen Spaß macht, kommunizieren Menschen nicht in erster Linie, um sich gegenseitig anzuschreien. Die berühmten Filterblasen, die viel weniger abgeschlossen sind als jeder analoge Freundeskreis, dienen oft vor allem der gegenseitigen Validierung des Liebzueinanderseins. Das mag man wiederum anstrengend finden, aber es ist doch sehr weit entfernt von der Vorstellung, dass einen auf Twitter unmittelbar und ausschließlich Mistgabeln und Fackeln erwarten.
Natürlich ist auch diese mediale Infrastruktur anfällig für überhitzte, zerstörerische Kommunikation. Den Mob, den Shitstorm oder den Troll gibt es wirklich. Aber es handelt sich um spezifische Phänomene, die ein breites Spektrum an Dunkelheit abdecken und die eine spezifische und vor allem intellektuell redliche Form der Analyse verdient haben.
Ein Beispiel für eine solche Analyse wäre der Essay von D.T. Max über neue Formen des „public shaming“ während der Pandemie; oder das nach wie vor sehr empfehlenswerte Buch „So You’ve Been Publicly Shamed“ von Jon Ronson. Whitney Phillips und Ryan M. Miller wiederum beschäftigen sich in ihrer Studie „The Ambivalent Internet“ mit dem extrem abstoßenden digitalen Phänomenen wie dem „RIP trolling“. Es handelt sich dabei um die Praxis, die zu digitalen Grabstätten umgebauten Facebookseiten verstorbener Menschen mit verachtenden Kommentaren zu überschütten.
Konkrete Menschen, die sich auf Twitter zu einem bestimmten Thema äußern, werden zu einem Kollektivsingular zusammengefasst, dem man alles in den Mund legen kann.
Ich erwähne diese Beispiele vor allem, um zu zeigen, dass es ein kulturjournalistisches und wissenschaftliches Schreiben über Internetphänomene gibt, das – durchaus kulturkritisch – die destruktiven Aspekte der digitalen Kommunikation auf verschiedenen sozialmedialen Plattformen auseinandernehmen kann, ohne dabei die extrem vage Rede vom Twittermob zu reproduzieren. Es gibt nämlich, gerade im deutschsprachigen Feuilleton, eine Tendenz, die Vorstellung der rasenden Meute auf Twitter immer wieder und wieder zu reproduzieren. Das gelingt vor allem dadurch, dass man sehr unkonkret bleibt, und die etablierten Regeln des Zitierens, die man bei jedem anderen Thema selbstverständlich einhalten würde, nicht beachtet. So werden konkrete Menschen, die sich auf Twitter zu einem bestimmten Thema äußern, zu einem Kollektivsingular zusammengefasst, dem man alles Mögliche unterstellen und in den Mund legen kann.
Der Politikwissenschaftler Yascha Mounk etwa schrieb im August dieses Jahres in der „Zeit“ über die angeblichen Auswüchsen einer „Twitter-Meute“, die im Dienst der sogenannten „Cancel Culture“ die Debattenkultur zerstören würde. Mounk nannte unter anderem das Beispiel der Auseinandersetzung um eine Wortmeldung von Dieter Nuhr, die die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) in einer Initiative zu ihrem hundertsten Jubiläum auf ihrer Internetseite veröffentlicht hatte. Das hatte zu Verstimmung geführt, da Nuhr wegen seiner Witze über Klimaaktivist*innen und zuletzt wegen eines Witzes über Angela Merkel und Christian Drosten vielen Menschen nicht unbedingt als angemessener Botschafter für die Wissenschaft erschien. Die DFG löschte Nuhrs Wortmeldung dann unter Verweis auf die Kritik, was wiederum zu heftiger Kritik führte.
Hier trat dann auch das rätselhafte Biest, der Twittermob, in Erscheinung. Mounk schrieb in seinem Text, die DFG habe „schafstreu einem Twitter-Shitstorm nachgegeben“ und rief die Entscheidungsträger dazu auf, sich nicht mehr „unrepräsentativen Twitter-Mobs“ zu beugen. Nuhr selbst nannte den Vorgang „die humane Variante des Pogroms“, denn auch in diesem Fall würde sich eine Masse zusammenrotten und zur sozialen Vernichtung ansetzen. Der Philosoph Philip Hübl wiederum klagte über einen „teils anonymen Twittermob“, und für Michael Hanfeld in der FAZ war der Fall ein Beispiel dafür, wie die „Netzmeute“ agiert. Er kritisierte, die DFG sei vor einem „Twittermob von ein paar hundert Leuten“ eingeknickt.
An dieser Stelle muss ich gestehen, dass auch ich Teil dieses „Mobs“ gewesen bin und die Beschreibung dessen, was sich auf Twitter abgespielt haben soll, bei mir eine gewisse kognitive Dissonanz ausgelöst hat. Zunächst einmal war die Kritik an der Entscheidung, Nuhr in diesem Zusammenhang auftreten zu lassen, alles andere als anonym. Sie kam aus der wissenschaftlichen Community, die sich ja überhaupt erst einmal für eine Institution wie die DFG interessiert.
Echt peinlich! Was will uns @dfg_public damit sagen? Dass wir keine Wissenschaftler*innen von Rang haben, in Deutschland, die die #Wissenschaft vertreten können?
Das läge dann ja wohl auch an der Forschungsförderung, oder?#wisskomm https://t.co/k6GyxGtR84— Jürgen Zimmerer (@juergenzimmerer) July 30, 2020
WARUM NUHR?
Mit Zwinkerzwinker #fürdaswissen, @dfg_public?
Mit welcher Begründung diese Einladung ausgesprochen wurde, wüsste ich gern. #DFG2020 https://t.co/tJPwPMZkJs— Tweetstürmchen (@geierandrea2017) July 30, 2020
Wie konnte das passieren? https://t.co/cAD7sN7SNV
— Armin Nassehi (@ArminNassehi) July 30, 2020
Die Kritik war teilweise sardonisch und heftig, bewegte sich allerdings weitgehend im Spektrum erträglicher verbaler Aggression – gerade im Vergleich zu einer Art der Kommunikation, in der es okay ist, Menschen als „Meute“ oder „Mob“ zu bezeichnen. Eine konkrete Beschreibung dieses kommunikativen Vorgangs, die vielleicht auch den ein oder anderen Tweet zitiert hätte, wäre jedenfalls zu einem vollkommen anderen Bild gekommen, als der Darstellung einer gesichtslosen Masse von Schreihälsen.
All das ändert nichts daran, dass die grundsätzlichen Streitfragen, ob die DFG die Wortmeldung von Nuhr hätte bringen sollen oder nicht, ob es richtig war, sie zu löschen und später wieder online zu stellen, kompliziert bleiben. Die Heraufbeschwörung des Mobs ist in diesem Fall ist vor allem ein Beispiel für eine bestimmte Form des unkonkreten Schreibens über ein sehr konkretes Phänomen. Die Fiktion der gesichtslosen Meute kann nur aufrecht erhalten werden, indem man keine einzige der doch angeblich zahlreichen Einzelstimmen zitiert, die diese Meute ja ausmachen soll. Digitale Anonymität ist etwas, das durch das Nichtnennen von Namen oft erst narrativ erzeugt werden muss. Und so erscheint diese Form des Twittermobs vor allem als Fantasma einer bestimmten Art des journalistischen Erzählens.
Es handelt sich um eine Strategie, die in den kulturpolitischen Kontroversen der letzten Jahre, an denen oft auch Menschen auf Twitter beteiligt waren, immer wieder zum Einsatz kam. Die erbitterte Debatte über den Nobelpreis für Peter Handke etwa wurde rasch auch zu einer medienpolitischen Auseinandersetzung darüber, wer sich wo mit Autorität zum Thema äußern dürfe.
Auch in diesem Fall ließ sich beobachten, wie das Schreiben über Twitter mit einer eigentümlichen Nachlässigkeit im Zitieren einherging. Die Schriftstellerin Nora Bossong etwa ging mit den Kritiker*innen Handkes auf Twitter hart ins Gericht. Sie ärgerte sich insbesondere über einen Witz, der über einen denkwürdigen Auftritt Handkes gemacht wurde, bei dem der Autor sich dagegen verwehrt hattee, auf die Kritik an der Preisvergabe einzugehen: „Ich bin ein Schriftsteller, komme von Tolstoi, ich komme von Homer, ich komme von Cervantes, lasst mich in Frieden und stellt mir nicht solche Fragen.“
Bossong begann ihre Kritik an der Twitter-Reaktion auf Handke dann folgendermaßen:
„‚Bist du schon mal von Tolstoi gekommen? – Ne, meistens von Oralsex.‘ So oder ähnlich geht der Witz, der neben viel Ad-hoc-Entrüstung auf die Verkündung des Literaturnobelpreises an Peter Handke folgte.“
Hier muss man allerdings schon einhaken, denn weder so oder so ähnlich ging der Witz, der während dieser Debatte auf Twitter kursierte. Zunächst einmal bezog er sich unter anderem auf ein ziemlich weit verbreitetes Tweet-Pattern, das mit der Phrase „Ja, Sex ist geil…“ beginnt, die dann durch etwas vervollständigt wird, was überraschenderweise noch besser ist.
Die unbeabsichtigte Zweideutigkeit von Handkes Aussage hatte sich perfekt angeboten, um etwas Luft aus dem inszenierten Geniemythos zu lassen. Es handelt sich aber auch nur um eine von vielen Variationen dieses Scherzes.
Das alles muss man nicht unbedingt wissen; außer natürlich, man schreibt einen polemischen Artikel darüber; dann ist es Teil der Recherche. Dann hätte man den Witz und seine Urheber*innen auch einfach mit Namensnennung zitieren können. Allerdings wäre dann auch das vernichtende Fazit nicht mehr plausibel gewesen:
„Weil man auf der richtigen Seite eh alles richtig macht, nahmen die Empörungen mitunter recht bizarre Formen an, von Witzen und Echauffierung oft nur des Hörensagens (der hat ja mal … geht ja gar nicht … ne, gelesen hab ich nichts von dem, und jetzt erst recht nicht!) bis zu Clownsauftritten war alles dabei. Vielleicht ist das mit dem ausbleibenden Tolstoi-Orgasmus auch gar nicht so sehr ein Witz als vielmehr Ausdruck davon, dass viele von jenen, die in tagespolitischer Tweetsprache zu Hause sind, tatsächlich noch nie von Weltliteratur in Ekstase geraten sind und sich einen langfristigen Aufenthalt dort gar nicht vorstellen können oder wollen.“
Gerade Polemik benötigt Redlichkeit.
Bei näherem Hinsehen hätte auffallen müssen, dass diese Analyse einfach nicht stimmt. Man kann die Witze über Handke immer noch geschmacklos finden oder die Kritik an seinem politischen Engagement unbegründet. Aber gerade Polemik benötigt Redlichkeit.
Die Unterstellung, die meisten Menschen auf Twitter würden Handke nur vom Hörensagen kennen, ergibt wenig Sinn. Den inkriminierten Witz kann man nur verstehen und würdigen, wenn man einigermaßen weiß, wer Handke ist, und einen Kontext zu seinem Werk und der Nobelpreisvergabe herstellen kann. Zudem muss man an Literatur soweit interessiert sein, dass man außerdem weiß, wer Homer, Tolstoi und Cervantes sind. Kurzum: Die sich da lustig gemacht haben, gehören absolut zum selben Milieu, wie die, die sie kritisieren.
Der Vorwurf des „Hörensagens“ lässt sich an dieser Stelle umdrehen. Denn anstatt wenigstens einen Tweet, wenigstens eine konkrete Stimme zu zitieren, werden Wortmeldungen kurzerhand erfunden oder so zusammengefasst, dass sie sich nicht mehr identifizieren lassen. Ein Zitat aus einem Text kann man überprüfen; die vage Paraphrase von etwas, was jemand im Internet gesagt haben soll, bleibt unüberprüfbar. So wird die Netzöffentlichkeit zum frei modellierbaren Spielmaterial einer kulturkritischen Analyse, die sich auf die Argumente und Haltung von Einzelstimmen nicht mehr einlassen muss, sondern daraus einen Popanz aufbauen kann, der dann argumentativ einfach zu erledigen ist.
Ähnlich verfuhr auch Thomas Melle in seiner Polemik gegen die digitale Kritik an Handke, die schon ziemlich eindeutig mit „Clowns auf Hetzjagd“ betitelt war. In diesem Artikel nannte Melle keinen einzigen Namen, was nicht nur ziemlich verwirrend für alle Leser*innen der FAZ gewesen sein muss, die nicht knietief in dieser Debatte steckten, sondern auch einfach ziemlich seltsam war, da es unter anderem um bekannte Autor*innen ging wie Margarete Stokowski („eine Journalistin“) oder Saša Stanišić („Die Stunde eines anderen Schriftstellers hat geschlagen.“). Aber diese Stimmen sollten hier ihre Individualität verlieren und in das Kollektiv zurücktreten, das auf Twitter angeblich einen „virtuellen Schauprozesses“ veranstaltet.
Melles Zusammenfassung der gesamten Debatte auf Twitter erfolgt nach diesem Muster:
„Fiebrig läuft die Beweisaufnahme. Ein twitterhyperaktiver Redakteur sendet Beleg nach Beleg hinterher, als seien Argumente einfach nicht mehr en vogue. Ein Journalist reagiert darauf mit einem Witz, der süffisant auftritt, aber kryptisch bleibt. Es sekundieren Hunderte von Klarnamen und Pseudonymen.“
Wer mögen sie gewesen sein, die Redakteure, die Journalisten und die Hunderten von Namen, die dann sekundiert haben? Man weiß es nicht, und wird es auch nicht mehr wirklich rekonstruieren können. Dabei wäre es einfach gewesen, spätestens in der Online-Version des Artikel, auf die entsprechenden Tweets zu verlinken. Stattdessen werden die Akteure ent-realisiert, indem man ihnen die Namensnennung und ein Zitat verweigert.
Wie Bossongs Vorwurf des „Hörensagens“ richtet sich auch Melles Fazit gegen sein eigenes Verfahren:
„Twitter, das den Puls der Meinungsmache vorgibt, richtet die Inhalte einfach auf diese Weise zu, formatiert sie in toxische Fetzen und süffisante Häppchen.“
Es geht an dieser Stelle nicht darum, diese Kontroversen noch einmal aufleben zu lassen. Es geht darum, ein besseres Schreiben über Twitter einzufordern. Und das heißt vor allem konkreter und redlicher zu zitieren. So wie es die Kommentator*innen im Fall Nuhr oder Nora Bossong und Thomas Melle verdient haben, mit ihren Argumenten ernst genommen zu werden, so haben es auch die Kolleg*innen auf Twitter verdient, dass man aus ihnen keine literarischen Figuren macht, die man dann mit wenig Aufwand zerlegen kann. Dann müsste man aber auch auf den Kollektivsingular des Twittermobs verzichten.
Dieser Verzicht fällt offenbar einigen sehr schwer – vielleicht, weil die Vorstellung von einer Netzmeute die kulturpolitische Funktion erfüllt, Teilhabe abzuwehren. Das konnte man etwa in der Kontroverse um die Polemik gegen den Pianisten Igor Levit beobachten, die der Musikkritiker Helmut Mauró vor ein paar Wochen in der „Süddeutschen Zeitung“ veröffentlicht hat. Interessant ist, wie stark der Autor seine Kritik an Levit auch zum Anlass nimmt, um eine paranoide Vorstellung davon zu beschwören, was auf so Twitter stattfindet. Von einem „diffusen Weltgericht“ ist da die Rede: „Es scheint ein opfermoralisch begründbares Recht auf Hass und Verleumdung zu geben, und nach Twitter-Art: ein neues Sofa-Richtertum.“
Was hier zum Ausdruck kommt, ist wieder die Angst vor einer neuen Gerichtsbarkeit, vor einer Instanz des Strafens, die sich über die etablierten Form des Strafens (etwa durch eine Polemik in der „Süddeutschen Zeitung“) hinwegsetzt. Auch hier bleibt die Medienkritik ausgesprochen vage. Das Weltgericht auf Twitter scheint zwar beängstigend und mächtig zu sein, aber nicht mächtig genug, dass man einmal ein paar Beispiele nennen könnte.
Diese Form des Kommentierens setzte sich fort, nachdem der Artikel naheliegenderweise den (digitalen) Zorn zahlreicher Menschen auf sich gezogen hatte. Christine Lemke-Matwey etwa schrieb in der „Zeit“, bei Twitter sei alles aufgefahren worden, was „die alarmistische Vernunft“ gebiete:
„Wer sich nicht dauernd im Netz tummelt, könnte es mit der Angst zu tun kriegen. Vor der Gnadenlosigkeit der Reflexe und vor Argumenten, die partout kein Gras mehr wachsen sehen wollen.“
Wieder bleibt die Kritik, deren Gnadenlosigkeit beklagt wird, gesichtslos. Ob die Klage valide ist, lässt sich nicht überprüfen. So wird auch in diesem Fall wieder die Tatsache verschleiert, dass es sich halt um die Kolleg*innen handelt, die hier bestimmte Aspekte des Mediensystems kritisieren. Es wäre nicht schwer, hier ein paar Namen zu nennen. Zum Antisemitismus-Vorwurf hat sich etwa Patrick Bahners geäußert. Die problematische Rhetorik des Artikels analysierte Natascha Strobl in einem langen Thread.
Diese Art des Schreibens über Twitter, die identifizierbare Einzelstimmen verschleiert, erreichte in der Debatte einen komischen Höhepunkt im Artikel des Kulturwissenschaftlers Andreas Bernhard. Dieser Artikel ist mir vielleicht vor allem deshalb so aufgefallen, weil ich darin (natürlich ohne Namen) vorkomme und falsch zitiert werde. Bernhards These ist, dass die Debatten um Maurós Artikel und ein Interview mit der Virologin Sandra Ciesek im „Spiegel“ auch Ausdruck einer Medienkonkurrenz zwischen Print-Medien und Twitter darstelle. Der Artikel in der „Süddeutschen Zeitung“ sei nicht „als singuläre Verfehlung“ gewertet worden, „sondern als Symptom einer im Niedergang begriffenen Branche.“ Dieser Angriff auf die journalistischen Institutionen leiste einer politisch gefährlichen „Erosion der Medienöffentlichkeit“ Vorschub.
Wer sich auf Twitter äußert, verwirkt offenbar das Recht darauf, mit Namen erwähnt zu werden.
Um diese These zu belegen, werden Stimmen aus dem Netz wie ein Chor zusammengetragen, ohne deren Namen zu nennen und ohne auf sie zu verlinken. Direkt zitiert wird unter anderem Georg Diez, der allerdings, da er sich auf Twitter äußert, offenbar das Recht darauf verwirkt hat, mit Namen erwähnt zu werden.
Direkt zitiert wird zudem ein Kommentator, der „am Ende seiner detaillierten Zerpflückungen“ das Fazit gezogen habe, dass „man print wirklich langsam hassen lernt“. Auf diesem Zitat, das in diesem Zusammenhang ziemlich blödsinnig wirkt, baut die Diagnose einer Spaltung von Print und Twitter auf. Als ich es nachgeschlagen habe (es ist ein Leichtes, mit der Twittersuchfunktion nach Urherbern von anonym zitierten Tweets zu suchen), musste ich feststellen, dass es leider von mir stammt. Allerdings ging es in meinem Tweet um etwas ganz anderes. Die Aussage stand keineswegs am Ende einer detaillierten Zerpflückung, sondern war ein Scherz über eine besonders überschwängliche Rezension, in der die neue Günter-Grass-Ausgabe als „frischduftend“ gelobt wurde.
Wie man print wirklich langsam hassen lernt.
— Johannes Franzen (@Johannes42) October 16, 2020
Der Hass, der hier von mir hier offensichtlich humoristisch gemeint war, galt also nicht den Print-Medien im Sinne von Zeitungen, sondern Print im Sinne des gedruckten Wortes; gemeint war der teilweise ziemlich kitschige Fetisch der materiellen Buchkultur. Es handelt sich um ein deutliches Fehlzitat, das der Kunstfigur des Kommentators, dem es in den Mund gelegt wird, eine medientheoretische Naivität unterstellt, die sich dann im Artikel mit großem Getöse widerlegen lässt.
Wäre hier richtig zitiert worden, dann hätte sich gezeigt, dass die grundsätzliche These nicht stimmt. Eine Spaltung zwischen „Print“ und „Twitter“ in dieser Form existiert nur in der Rhetorik eines allgemeinen Kampfes um Deutungsmacht. Dieser Kampf wurde auch lange vor dem Internet gekämpft und gehört zu den normalen und gesunden Konflikten in einer offenen Gesellschaft. Es geht nicht um ein System Print, das von außen unter Beschuss steht, sondern um politische und kulturelle Auseinandersetzungen um Teilaspekte einer publizistischen Öffentlichkeit, die immer geführt werden.
Medienkritik, wie etwa die Kritik an einer sexistischen oder rassistischen Sprache, ist kein Angriff auf die Institution des Journalismus, sondern steht im Dienst seiner Verteidigung und Verbesserung. Und die Kritik an Gatekeepern ist kein revolutionärer Aufruf, das gesamte publizistische System zu zerstören, sondern eine Forderung nach mehr Teilhabe.
Es ist eine unglückliche Erscheinung, dass ausgerechnet bei der angeblichen Verteidigung dieser Institutionen gegen die Fiktion eines gesichtslosen Mobs die etablierten Grundregeln, die diese Institutionen auszeichnen, verletzt werden. Wenn man es mit der (berechtigten) Kritik an Problemen der Netzöffentlichkeit wirklich ernst meint, dann sollte man damit anfangen, wieder richtig zu zitieren. Die digitalen Umwälzungen des Mediensystems erzeugen genug reale Herausforderungen, denen man nur mit einem feuilletonistischen und wissenschaftlichen Schreiben nah an den Phänomenen beikommen kann. Es ergibt keinen Sinn, im Dienste einer vagen Kulturkritik gegen erfundene Schreckgespenster zu kämpfen.
Danke für diesen Artikel! Da ich vorwiegend nur Guardian (online) lese, bin ich irgendwie total dran gewöhnt, dass regelmäßig die Akteure, die sich auf Twitter äußern mit Namen zitiert und verlinkt oder eingebettet werden
„… So oder ähnlich geht der Witz, der neben viel Ad-hoc-Entrüstung auf die Verkündung des Literaturnobelpreises an Peter Handke folgte.“
So oder so ähnlich? Ohne weitere Angaben?
„…sollte man damit anfangen, wieder richtig zu zitieren. “
keine weiteren Fragen ;)
Apropos Namen: Der „Gregor Diez“ heißt doch wohl Georg.
Printtext Melle:
„Ein twitterhyperaktiver Redakteur“ ->: Bahners?
„sendet Beleg nach Beleg hinterher“ -> ist als Vorwurf irgendwie seltsam…
In der Dialektik gibt es den berühmten Umschlag von Quantität in Qualität: Wenn zehn Autos gleichzeitig auf die Autobahn nach Süden starten, sind das zehn Autos auf der Autobahn. Wenn zehntausend Autos dasselbe tun, ist das eine Reisewelle (und ein Monster-Stau).
Wenn zehn Leute auf Twitter unter demselben Hashtag in ähnlichem Sinn die Aussage einer Person kritisieren, dann kritisieren zehn Leute auf Twitter. Wenn zehntausend Leute gleichzeitig dasselbe tun, ist das ein Shitstorm.
Das entscheidende ist in beiden Fällen nicht das einzelne Auto oder die einzelne Person, sondern der Massencharakter. Herr Franzen fordert nun, bei der Kritik eines Shitstorms müsse man den einzelnen Beitrag und den einzelnen Verfasser zitieren – doch darauf reduziert, würde man den Massencharakter negieren, und der ist für die Wirkungsweise zentral.
Wer einen Shitstorm (oder irgendeine auch positive Welle auf Twitter) erfassen will, muss einen Grundtenor aus vielen Tweets herausdestillieren. Nora Bossong macht das mit dem „so oder so ähnlich“ bei der Handke-Tolstoi-Geschichte m.E. ganz gut – was Franzen ungewollt bestätigt, indem er mehrere sehr ähnliche Scherze verlinkt. Helmut Mauró macht es bei der Igor-Levit-Geschichte völlig falsch.
Die Unterschiede hätte Franzen herausarbeiten können. Er tut es nicht – weshalb ich den Eindruck habe, hier will sich ein Twitter-Fan mit viel Aufwand jegliches Unbehagen über die Wirkung seines Lieblingsmediums vom Hals halten.
@ 2. Christian
Ist das Ironie oder meinen Sie das ernst?
Ich musste etwas lachen als ich mir die Stelle im Artikel und Ihre Zitation dazu angeschaut habe.
@Kritischer Kritiker
Ich glaube, da stellt sich anders als beim Stau, wo man es sehr genau messen kann dann ab und zu mal die Frage, ob es wirklich eine derart hohe Anzahl originär Twitter-Beiträge waren und es wirklich nicht mehr möglich war, die relevantesten und prominentesten zu begutachten. Der Twitter-Mechanismus führt ja dazu, dass nur eine gewisse Anzahl zur menschlichen Rezeption überall oben auftaucht und diese Anzahl ist per definitionem stark begrenzt.
Wo ist die kritische Masse, wo die zahlreiche Kritik zum Shitstorm wird? Sicher sehr kontextabhängig und insbesondere auch vom Tonfall der Agierenden.
Das Narrativ sitzt halt immer locker, selbst wenn es vielleicht nur 20-30 Beiträge waren. Die vom Autor zitierten Tweets haben im Fall Handkes so um die 2.000 Likes und im Fall Nuhr habe ich bei einem sogar nur 1.000 Likes gesehen. Die Anzahl originärer Kommentare dürfte also jeweils weit darunter liegen.
Mal ein Vergleich:
Valerie Höhne schreibt auf Spiegel Online das relativ harmlose „Endlich mal eine Frau!“ in Bezug auf Kamala Harris und es gibt knapp 1000 originäre Kommentare, die in der großen Mehrzahl sehr hämisch über das feministische Anliegen herziehen und das größtenteils anonymisiert (zumindest gegenüber der Öffentlichkeit, SPON kennt eine Emailadresse). Und so geht das bei vielen Artikeln.
Relativ dazu finde ich das Geschehen auf Twitter meist recht zivilisiert und ich frage mich, ob der Massencharakter wirklich so oft so unerträglich ist, wie da behauptet wird.
Aus Sicht des Informatikers sehe ich Twitter übrigens als beliebig austauschbar an mit jeder anderen offenen Kommunikationsplattform/Forum. Das erzeugt in mir den Verdacht, dass Twitter vor allem deshalb zur Zielscheibe der konservativen Klagen wird, weil die meisten Nutzer dort eher links-progressiv sind, während z.B. das Niedermachen feministischer Texte in Online-Foren der sonstigen Massenmedien halt keinen interessiert. Oder man sich mit den Kritisierten aus dem eigenen Milieu mehr identifiziert und sie deshalb verteidigt.
Nachtrag:
Aha: Herr Franzen hasst also keine Zeitungen, sondern nur Bücher. Vor allem, wenn sie schön gedruckt sind. Und das ist Humor – *haha*.
Der von ihm via Twitter aufs Korn genommene Text ist entweder selbst eine Verballhornung oder ein Stilblüten-Alptraum. Wir wissen es nicht, denn Franzen nennt keinen Ursprung, sondern zerrt ihn herbei, um die „materielle Buchkultur“ als „kitschigen Fetisch“ zu denunzieren.
Kurz: Er verwendet mehrere tausend Wörter darauf, Twitter-Kritik für irrelevant zu erklären, weil sie Ross und Reiter nicht nenne – und tritt dann die Buchkultur mithilfe eines Zitats in den Orkus, dessen Ross und Reiter er nicht nennt.
Was haben wir gelacht!
@KK
Der Artikel in der Zeit, auf die sich Herr Franzen mit dem Zitat bezieht, ist doch verlinkt, wie Sie ja auch feststellen. Sie können dem doch nachgehen, wenn Sie wollen.
Man muss ja nicht seiner Meinung sein oder es lustig finden oder sogar finden, er hätte den Zeit-Artikel nicht verstanden, um zu sehen, dass sein Zitat aus dem Kontext (i.e. der Bezug zu einem speziellen kritisierten Text über gedruckte Bücher) gerissen wurde.
Die Unterstellung, er möge keine Bücher bzw verabscheue die gesamte Buchkultur, daraus abzuleiten, ist Entschuldigung, bösartig oder dumm. Das Zitat ist ganz eindeutig eine Bewertung des einen speziellen verlinkten Artikels.
Ja, er schreibt hier verallgemeinernd vom „teilweise ziemlich kitschigen Fetisch der Buchkultur“ mit nur einem einzigen Beleg (immerhin allerdings). Aber: In den Orkus treten ist was anderes. Und: Das würde ja nun in diesem Artikel etwas off-topic gehen, wenn er diese Ansicht hier ausführlich begründet. Für diesen Artikel war es funktional notwendig den Kontext seines zitierten Tweets darzulegen, mehr nicht.
Wir leben in einer medialen Revolution. 800 v. Chr Griechenland importiert die Schrift aus dem mittleren Osten, im 15.Jhd hält die Buchdruckkunst Einzug und nun der Computer.
Und natürlich war es für einige auch immer der kulturelle Untergang. Vorbei die Alleinherrschaft der endlos gereimten Heldenepen, vorbei die Alleinherrschaft der sakralen, handschriftlich verbreiteten Folianten, vorbei die Alleinherrschaft der gedruckten Geschichten.
Ebenso war es aber auch immer die Geburt neuer, aufregender Möglichkeiten, ohne die wir uns Gegenwartskultur gar nicht vorstellen könnten.
Was mich immer gewundert hat ist, wie Menschen, die letztlich Konsalik und Äquivalente lesen, auf Computernutzer herabsehen könne, weil es sich ja um ein Buch handelt, und nicht um elektronische Medien, die sie konsumieren.
Das ist natürlich albern und ein Buch kein Wert an sich. Es kann auch einfach Müll sein.
Ähnlich willkürlich ist meist die derzeitige „shitstorm“ oder „cancel-culture“ hype. Nicht die Anzahl der Beiträge delegitimiert irgendetwas. Wie absurd wäre das denn? Eine Kritik verliert an Wert, weil viele sie teilen?
Neue Medien führen zu geändertem Stil und Ausdruck, ja zu ganz neuer Sprache. es bleibt aber leicht, zu unterscheiden, ob eine einzelne Person massiv bedroht wird, von einer Masse anonymisierter Troll Accounts, oder ob einem Medienimperium ein #haltdiefresse vielstimmig um die Ohren bekommt. Ob jemand sich und die Familie mit Mord bedroht sieht, oder ob ein Mogul sich wegen schlechter PR in den social media ärgert.
Klar kann man sich blöd stellen und es fällt manchen auch einfach leichter, aber es ist ein Pyrrhussieg. Man kann damit eine Weile Teile der Boomer Generation und deren Modernisierungskrise bespielen, aber das mendelt sich aus und nichts bleibt.
@5: Sie haben natürlich vollkommen Recht. Habe den Text wohl zu schnell überflogen.
Dadurch dass sich der Author zuerst als Teil des Mobs beschreibt und gleichzeitig erklärt den gäbe es gar nicht,
entsteht bei mir ebenfalls eine kognitive Dissonanz, die mich etwas hilflos zurücklässt.
Entweder habe ich sachlich an der Diskussion teilgenommen, dann brauche ich mich doch nicht dem Mob zugehörig finden,
oder aber ich habe meiner Aggression freien Lauf gelassen, dann ist die Sache klar.
Auf jeden Fall würde ich mir Gedanken machen, in welcher Gesellschaft ich mich da befinde, und ob ich mich dieser Gruppe anschließen möchte oder mich besser distanzieren sollte.
Sätze wie: „Aber gerade Polemik benötigt Redlichkeit.“ erzeugen bei mir allerdings einen akuten Würgreflex.
Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wie man all diesen Hass und die Aggression, die einem auf Twitter oder sonstigen Netzwerken begegnen, so verharmlosen kann.
@ Peter Sievert (#6 und #8):
Aus Sicht des PR-Frekels glaube ich, Twitter hat eine Sonderrolle, weil dort soviele Journalisten, Promis und Politiker mit Klarnamen unterwegs sind. Dadurch bekommen Tweets zu „trendenden“ Themen ein wenig den Charakter von kleinen Pressemitteilungen, die dann in journalistischen Online-Medien rauf und runter zitiert werden.
Ein Tweet von Promi X steht dann in der medialen Wahrnehmung für tausende (real oder vermeintlich vorhandene) ähnliche Beiträge der ominösen „Netzgemeinde“, und das macht die Schlagkraft aus.
Auch der Eindruck eines linksliberalen Mediums dürfte mit diesem Status zu tun haben. Aber stimmt er? Alice Weidel hat fast 109.000 Follower, Jörg Meuthen 70.000. Und der Besetzer des Weißen Hauses fast 89 Mio.
Bösartig oder dumm weise ich von mir, aber ich habe in #7 überzogen. Abbitte an Herrn Franzen. Was gedruckte Bücher angeht, bin ich sehr empfindlich. Unter anderem, weil sich das Narrativ, das auch Frank Gemein bedient, so großer Verbreitung erfreut: Wir sind in einer Revolution, das Buch ist was für alte Leute, bald verschwunden, so what? Die tollen neuen Möglichkeiten…
Ich habe halt die Befürchtung, dass diese Erzählung stimmt – und dass eine mühsam über Jahrhunderte erworbene Kulturtechnik binnen zwei, drei Generationen verschwinden wird. Es geht um die Fähigkeit des tiefen, versunkenen Lesens, die zu erlernen von Büchern ermöglicht wird (weil sie Konzentration erleichtern), von Bildschirmen aber nicht (weil sie Zerstreuung fördern).* Konsalik würde ich nicht hinterhertrauern, Tolstoi und Handke sehr wohl.
*Analog dazu: Die Fähigkeit zu musizieren ist nach der Verbreitung von Radio und Plattenspieler von einem Massen- zu einem Nischenphänomen geworden. Die Praxis der Hausmusik, deren Höhepunkt im 19. Jahrhundert erreicht war, ist fast völlig verschwunden. Sowas ist Regression durch Fortschritt und macht mich traurig.
@Kritischer Kritiker
In den Anfangszeiten und teilweise jetzt noch glaubten vor allem Journalisten und Politiker naiverweise , sie könnten auf Twitter zwischen Privat und Beruf unterscheiden. („Bin hier privat“)
Sie wurden schnell eines besseren belehrt, da die Öffentlichkeit und der politische Gegner diese Unterscheidung natürlich nicht macht und gerade kontroverse Tweets dem Arbeitgeber oder der Partei zurechnet, was dann nicht selten zu den bekannten Eskalationen führt.
Ich hoffe, Sie sehen es einem früheren exzessiven Buchleser nicht nach, wenn er zur Schonung seiner ziemlich beanspruchten Augen jetzt nur noch auf Hörbücher zurückgreift.
Ein professionell vorgetragenes Hörbuch, das obendrein nicht durch willkürliche Kürzung verstümmelt wurde, ist für mich persönlich ein Segen. Ich lasse lesen und vermisse das „echte“ Buch nicht mehr.
Dieser Kommentar hier greift das Thema auch auf:
https://www.salonkolumnisten.com/das-internet-werkzeug-der-populisten/
Meiner Meinung nach ist das „anonymisieren“ durch Mob-Zuweisung nur eine Stilblüte. Andersherum, also einen Protagonisten aus einer Menge von Kritikern herauszuziehen und für alles, was diese Menge sagt verantwortlich zu machen ebenfalls.
Ein Medium transportiert nur den Hass, der der jeweiligen Person innewohnt – bei Twitter halt ungefiltert.
„Reconquista Internet“ scheint zu funktionieren, siehe Netzpolitik Beitrag vom 08.06.2020.
Hm, das war zu erwarten.
Tenor; Früher war alles besser.
Also zunächst schreibt Herr Franzen einen ganzen Artikel darüber, dass so manch ein, als „shitstorm“ bezeichnetes Aufwallen im Netz, eben nicht zwangsweise aus Pöbelei, Bedrohung oder Verbalkrawall bestehen muss. Meist wird ja die reine Anzahl der Wortmeldungen als hinreichendes Indiz für einen solchen genommen.
Die Bezeichnung „shitstorm“ kommt dann wohlfeil, um sich nicht inhaltlich erklären zu müssen.
Wir wissen sehr genau, wie manche Menschen via Twitter, Email oder auch Telefon bedroht werden, wie wir auch wissen, dass den Worten eben manchmal auch Taten folgen.
Für Andere aber ist jegliche Kritik an Ihnen ein shitstorm, so sie eben von vielen und über Twitter geäußert wird. Das nutzt sich ab und hat mit den ernsten Fällen gar nichts zu tun.
Zum Anderen:
Ja, es gibt auch kaum noch Kinopianisten. Dieser furchtbare Tonfilm hat sie ausgelöscht.
Hausmusik wird weniger gespielt, house-music aber umso öfter.
Im Studium wurden wir mal mit realistischen Zahlen konfrontiert, wie viel im ausgehenden 19.ten Jahrhundert gelesen wurde. Es war sehr sehr wenig, verglichen mit heute, auch weil es die allg. Schulpflicht noch nicht gab. Und das, was gelesen wurde, war zu > 90% furchtbarer Schund. Kolportageromane über Kriegshelden, stramme Husaren, verarmte Grafen und strahlend weisse Mediziner.
Die unter uns, die 3 Stunden lang Hexa- und Pentameter aneinander reihen können, und ganze Epen so frei vortragen, sind durch die Einführung der Schrift sehr selten geworden. Ohne Schrift waren sie ein Muss und nicht wenige werden das beklagt und den kulturellen Verfall beweint haben.
Der Schund, den Menschen wie der junge Karl May in Heftform gegossen haben, wäre ohne Buchdruck nie erschienen. Die wunderbaren, reich mit Motiven und Ornamenten geschmückten Bücher sind nun selten geworden.
Und vor allem: Wenn Sie sich zurück erinnern, an eine Zeit, in der so viel mehr kritische, politisch aktive Menschen um Sie herum waren, als es heute zu geben scheint, dann liegt das meist daran, dass Sie nicht mehr jung sind. Dass Ihnen das heute auffällt, liegt daran, dass Sie ein Mensch sind, der sich solche Fragen stellt. Und Sie haben sich stets mit Menschen umgeben, die sich solche Fragen stellten. Die Masse aber war und ist das nie gewesen.
Ich kenne zwar wenige Hausmusiker, aber viele junge Musiker. Viel mehr, als in meiner Jugend. Mit alten- und neuem Instrumentarium.
Ich bin selber Boomer, bald 60, alter IT-ler und Linux Hase.
Ich weiss Bücher sehr zu schätzen, aber auch die neuen Medien. Ich glaube das Lamento gegen sie ist Jahrtausende alt. Zu Zeiten wie der Unsrigen natürlich lauter, weil wir im Umbruch leben. Aber überhaupt nicht neu.
@ Frank Gemein:
Das „Früher war alles besser“ haben Sie mir untergeschoben. So denke ich nicht. Brauchen wir aber nicht zu vertiefen. Ist ja Off Topic.
Festhalten können wir noch, dass ich anscheinend 15 Jahre jünger bin als Sie. Also können Sie sich das Generationen-Argument künftig sparen.
„Festhalten können wir noch, dass ich anscheinend 15 Jahre jünger bin als Sie. Also können Sie sich das Generationen-Argument künftig sparen.“
Ich wäre ja mal gespannt, was Sie meinen, wenn Sie von einem „Generationen-Argument“ schreiben. Bin mir da keiner Schuld bewusst, aber gut, das muss nicht stimmen.
Ich sehe mich als ITler durchaus gelegentlich zur Verteidigung der neuen Medien aufgerufen. Außerdem bin ich ein privilegierter alter weisser Sack, versuche aber diese Anlagen zum Wohle aller im Zaum zu halten.
@KK: Ich bin ja auch so ein kitschiger Printliebhaber und kann mit E-Readern usw. nix anfangen. Dennoch würde ich bestreiten, dass Bildschirme grundsätzlich Zerstreuung fördern. PC und Smartphone sicher, aber mit dem Reader lässt sich doch genauso vertieft lesen wie in einem gedruckten Buch – ob nun Homer, Adorno oder Konsalik.
@Frank Gemein (#16), ich meine z.B. das hier:
Ich plädiere hier immer dafür, Argumente als solche zu kritisieren und sich Schubladen wie „Boomer“ oder „alter, weißer Mann“ zu sparen. Ich bediene sie jedenfalls nicht – ich habe mich nie einer „Generation“ zugehörig gefühlt. Und für einen „Boomer“ bin ich mindestens 11 Jahre zu jung.
Aber auch bei diesem Thema bin ich, zugegeben, empfindlich. Mir wurde von einem anderen Kommentator mal geraten, ich solle mir Hilfe bei Jüngeren suchen, weil ich die Welt nicht mehr verstünde. Nun neige ich dazu, alles in dieser Richtung zu interpretieren. Wenn’s so nicht gemeint war, ziehe ich die Anmerkung zurück.
Nun, auch ein realer Mob auf einer realen Straße würde aus realen Menschen bestehen, auch, wenn man nicht unbedingt wüsste, wie die alle heißen.
Andererseits hat der Verfasser natürlich recht, dass ein Twittermob nicht nur aus Anonymen besteht, sondern auch viele per Klarname unterwegs sind, und – vor allem – dass eine Online-Zeitung kein Problem damit haben sollte, beispielhafte Tweets nicht nur zu zitieren, sondern auch zu verlinken.
@18
Nein, Sie waren nicht einmal persönlich damit gemeint. Den Konditionalsatz darf sich „anziehen“ wer will. Oder es komplett lassen.
Wenn – dann, dafür sind die ja da.
Ich plädiere einfach dafür, aus diesem Grabendenken altneu auszusteigen. Die neuen Medien haben nach meinem Dafürhalten erheblich viel mehr Gutes-, als Böses gebracht. Auch wenn das Üble derzeit sehr laut und stinkend daherkommt.
@KK
Absolute Zustimmung: Twitter wird zu Twitter durch die Menschen, die dort sind und sich öffentlich mit Klarnamen äußern. Das Phänomen ist sozialer und nicht technischer Natur (technisch halt eher unspektakulär).
Ansonsten bin ich optimistisch, was die Zukunft des gedruckten Buches angeht. Habe zwar auch viel auf dem E-Reader gelesen in den letzten 10 Jahren, aber Kinder lieben immer noch echte Bücher und werden damit ab dem Kleinkindalter sozialisiert, so meine Beobachtung im eigenen Heim und bei Verwandten und Freunden, und dadurch wird sich diese Kulturtechnik noch lange erhalten, vermute ich. Eine weitere Bauchvermutung: Wer heute nur am Smartphone hängt, hätte auch vor 20 Jahren nicht zum Buch gegriffen und die Lesequote echter Bücher war unter meinen Mitschülern damals ebenfalls niedrig und gefühlt dieselbe wie heute bei meinen Schülern.
@Frank Gemein
Ich denke interessanterweise oft genau das Gegenteil: Das meine Generation, geboren in den 80ern, sozialisiert in den 90ern, viel zu unpolitisch ist, weil damals alles so schien, als würde alles super werden. Oder genauer gesagt, politisch nicht aktiv genug, so nach dem Motto: „Wende erreicht, Kalter Krieg vorbei, Ozonloch geflickt, CO2 wissen wir Bescheid, was zu tun ist, … läuft doch.“ Da habe ich bei den 90ern und 2000ern das Gefühl, dass die politisch aktiver sind. Aber vielleicht ist das auch einfach ein Irrglaube.
@ Earendil (#17):
Stimmt schon, aber man verzichtet doch meist auf einiges, wenn man den E-Reader nimmt. Z.B. einen lesefreundlichen Satz, einen guten Kontrast zwischen Papier und Schrift, eine elegante Schrifttype, etc. Kleiner Lesetipp: https://www.wallstein-verlag.de/9783835314351-roland-reuss-die-perfekte-lesemaschine.html
Dazu kommt, dass die Rechteverwaltung bei Readern der reinste Alptraum ist. Wenn man Pech hat, ist die ganze „Bibliothek“ futsch, oder Texte werden im nachhinein verändert.
@ Peter Sievert (#21):
Hoffen wir es. Leider saugt das Smartphone, sobald es einmal da ist, die meiste Kinder-Konzentration auf sich – und mit 10 Jahren ist die Bücher-Sozialisation noch lange nicht abgeschlossen. Zudem trifft das Problem auch Erwachsene. Mir selbst fällt es seit ein paar Jahren immer schwerer, bei anspruchsvolleren Sachen in den Lese-Flow zu kommen, und ich leide darunter.
Den Eindruck hatte ich schon von meiner Alterskohorte (Jahrgang ’75). Deshalb konnte ich mit dem Generationen-Begriff auch nie viel anfangen. Das „Lebensgefühl meiner Generation“, so es das gibt, habe ich nie geteilt.
Muss ja furchtbar sein, dieses Twitter. Eine Schande, dass man Menschen zwingt, so etwas zu nutzen.