Mehr zum Thema MeToo
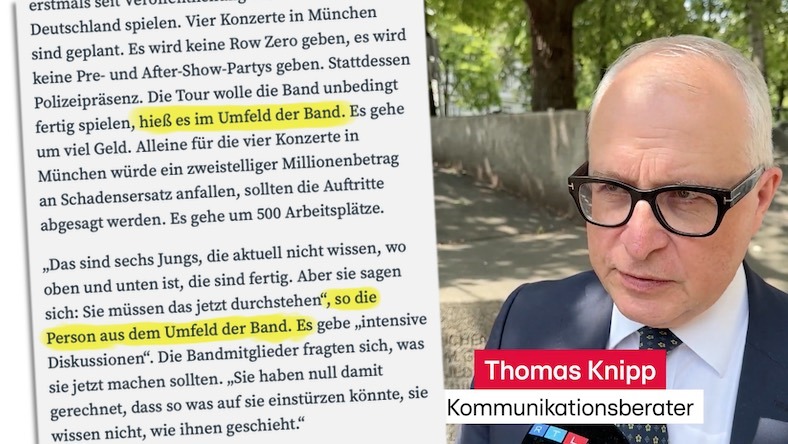

Journalisten lieben das Prinzip der Fallhöhe: Wenn Menschen sehr hoch fliegen, also etwa erfolgreich oder prominent sind, können diese auch sehr tief stürzen. Fallhöhe, so wird es an Journalistenschulen gelehrt, schafft Spannung.
Auch beim „Stern“ haben sie dieses Prinzip verinnerlicht. Als das Magazin Anfang März 2024 seine Geschichte über den damaligen grünen Europa-Abgeordneten Malte Gallée veröffentlicht, schreibt es: „Fall Malte Gallée: Ein grüner Ikarus“. Der tragische Held aus der griechischen Mythologie, der bei seinem vermessenen Flugversuch der Sonne zu nahekommt und ins Meer stürzt, ist geradezu der Prototyp einer Figur mit großer Fallhöhe.
Gallée, Jahrgang 1993, gehörte unter den 705 Europa-Abgeordneten der letzten Legislaturperiode noch nicht zur Politprominenz. Er hatte sein Mandat erst im Dezember 2021 übernommen und war das jüngste deutsche Mitglied des Parlaments. Doch medial lief es gut für ihn: Auf TikTok hatte er 50.000 Follower, „Zeit Campus“ kürte ihn 2023 zu den „30 Menschen bis 30, die uns Mut schenken“. Oder, wie der „Stern“ schreibt: „Gallée schwebte unaufhörlich in Richtung Macht.“
Sein Absturz war allerdings steil und hart – und damit hatte auch die Berichterstattung des „Stern“ zu tun. Denn so steht öffentlich der Vorwurf sexueller Belästigung im Raum, ausgerechnet bei den Grünen. Kaum eine andere Partei macht sich so sehr gegen sexuelle Diskriminierung stark. Auch hier wieder: große Fallhöhe.
Vom „Stern“ nach einer Sitzung angesprochen, sagt Gallée: „In meiner Welt ist das nicht passiert.“ Und weiter heißt es in dem Text: „Er stellt Gegenfragen, antwortet nicht, nach wenigen Minuten stürzt er unter Tränen davon.“ Einer, der „schwebte“, „stürzt“ jetzt also ganz wörtlich. Eine vielversprechende politische Karriere ist damit vorerst beendet.
Doch die Recherche des „Stern“ wirft auf den zweiten Blick Fragen auf – und erscheint heute teilweise in neuem Licht. Das hat auch mit Erkenntnissen aus dem Fall Stefan Gelbhaar zu tun.
Wie viele MeToo-Berichterstattungen bewegt sich der Text auf einem schmalen Grat: Es gilt Quellen zu schützen, Betroffenen Glauben zu schenken und Fehlverhalten auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze sichtbar zu machen. Gleichzeitig werden Menschen damit öffentlich mit erheblichen Vorwürfen konfrontiert.
Diese Form der Berichterstattung erfordert einen enormen Vertrauensvorschuss gegenüber einem Medium. Denn wie sorgfältig Aussagen von Betroffenen verifiziert wurden, wie valide anonyme Quellen wirklich sind und wie unangemessen das geschilderte Verhalten letztlich war – das alles können Leserinnen und Leser nur anhand der journalistischen Darstellung nachvollziehen.
Im Fall Gallée lässt der „Stern“ seine Leserschaft dabei jedoch ziemlich im Dunklen und will auch auf Nachfrage kein Licht in die Sache bringen.
Laut dem Bericht hatten mehrere Personen aus dem Mitarbeiterstab der Fraktion dem Magazin über Gallées mutmaßlich übergriffiges Verhalten berichtet. Die schwerwiegendste Anschuldigung: sexuelle Belästigung – ein möglicher Straftatbestand. Eine Frau berichtet dem „Stern“, dass der Politiker sie während einer Klausur nahe Paris „wiederholt angefasst habe, am Hintern, an Hüfte und Taille“. Im Strafgesetzbuch heißt es: „Wer eine andere Person in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und dadurch belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“

Auf Anfrage von Übermedien schreibt Malte Gallée, ähnlich wie schon in seinen vorigen öffentlichen Äußerungen dazu, er könne diesen Vorwurf nicht nachvollziehen: „Ich kenne dieses Gerücht nur aus der Presse und kann mir beim besten Willen nicht zusammenreimen, wer das sein soll.“ Er habe stets versucht, alle Mitarbeitenden „wie Freundinnen und Freunde zu behandeln“.
Damit steht, wie so oft in Fällen von mutmaßlicher sexueller Belästigung, Aussage gegen Aussage. Eine entsprechende Strafanzeige ist nicht bekannt.
Eine MeToo-Recherche wird dadurch jedoch nicht unzulässig. Einige Investigativ-Berichte der letzten Jahre, etwa über den ehemaligen „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt oder den Rammstein-Sänger Till Lindemann haben gezeigt, dass (Macht-)Missbrauch auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze stattfinden, eine Verdachtsberichterstattung jedoch teilweise gerechtfertigt sein kann. Und gerade weil meist Aussage gegen Aussage steht und Betroffene häufig anonym bleiben wollen, haben es diese besonders schwer, gehört und ernstgenommen zu werden. Medien können eine wichtige Rolle dabei spielen, ihnen eine Stimme zu geben.
Dafür bedarf es neben einem öffentlichen Interesse (das im Fall eines Europa-Abgeordneten gegeben ist) auch einer sorgfältigen Recherche, eines Mindestbestands an Beweistatsachen sowie einer angemessenen Darstellung. Es darf also keine Vorverurteilung stattfinden, auch entlastende Informationen müssen geschildert werden.
Was das genau bedeutet, wird in der Branche – aber vor allem auch vor Gerichten – ständig ausgelotet. Im Fall Gallée bleibt jedoch allein anhand des Berichts unklar, wie viele Beweistatsachen es tatsächlich gibt und wie ausgewogen der „Stern“ Gallée und sein Verhalten darstellt.
Denn die Aussage über den Vorfall bei Paris bleibt die konkreteste Anschuldigung im Artikel: Sie enthält einen Ort, einen Zeitpunkt und eine klar benannte Handlung. Das Problem ist, dass der übrige Text vor allem aus deutlich weniger klaren Aussagen besteht.
So soll Gallée etwa „Frauen in Gesprächen oft sehr nahegekommen sein, zu nah. Soll manche lange und zu eng umarmt (haben)“. Angesichts des schweren Vorwurfs mag es kleinlich klingen, aber: Wie nah ist zu nah? Ab wann ist eine Umarmung lang oder zu eng? Und noch viel wichtiger: Schildern dies Betroffene – oder Menschen, die solche Umarmungen nur beobachtet haben? Genauer wird der „Stern“ hier allerdings nicht.
An anderen Stellen heißt es, Gallée habe Frauen „aus seinem Intimleben berichtet und sehr private Fragen“ sowie „indiskrete Fragen zu ihrem Liebesleben gestellt“. Das klingt nach einem unangemessenen Verhalten. Gleichzeitig ist aber auch wahr: Was als „sehr privat“, „indiskret“ oder gar „intim“ wahrgenommen wird, legen Menschen je nach Persönlichkeit oder individueller Prägung sehr verschieden aus. Doch was genau vorgefallen sein soll, bleibt im „Stern“ völlig unklar: Eine konkrete Aussage, die Gallée getroffen haben soll, fehlt in dem Text. So wird es der Fantasie der Leserinnen und Leser überlassen, was er berichtet und gefragt haben soll.
Zwei Sätze könnten diese Fantasie noch beflügeln: „Gallée sei „immer auf der Jagd“, behaupten mehrere Frauen übereinstimmend. Und: „Sei er in der Nähe, hätten Assistentinnen ihre Praktikantinnen ungern aus den Augen gelassen und sie mitunter bis nach Hause begleitet.“ Man bekommt hier leicht den Eindruck, der Nachwuchspolitiker sei ein Triebtäter, der junge Frauen regelmäßig bis nach Hause verfolgt, wenn ihre Chefinnen sie nicht vor ihm beschützen. Doch ist so etwas jemals vorgefallen? Die „Stern“-Reporter haben jedenfalls nichts darüber zu berichten.
Passend zum so vermittelten Eindruck lautet die Überschrift der Online-Version dann auch: „Ich hatte richtig Angst vor ihm.“ Allerdings bezieht sich diese Aussage gar nicht auf Gallées mutmaßliches Verhalten gegenüber Frauen. Vielmehr stammt der Satz aus einer kurzen Passage, in der der „Stern“ plötzlich noch ein paar Zeilen zu dessen Rolle als Führungskraft einstreut. So sollen Betroffene und Zeuginnen berichten, „wie Gallée im Büro ausfallend geworden sein soll und Mitarbeitende unter Druck gesetzt habe“. Aber auch hier: Mehr erfährt man nicht.
Gallée selbst gibt an, er könne die Vorwürfe nicht zuordnen, und fordert selbst deren „lückenlose Aufklärung“. Er wisse bis heute nicht, was genau wann passiert sein soll. Angenommen, die Vorwürfe im „Stern“ wären konkreter formuliert – es würde ihm vermutlich deutlich schwerer fallen, sie zu bestreiten. Auf die Frage von Übermedien, warum die Schilderungen nicht präzisiert wurden, gibt eine Sprecherin in ihrer Stellungnahme keine Antwort.
Vage bleibt der Text auch bei den Angaben zu seinen Quellen. Zwar müssen Journalisten diese schützen, Recherchen sollten aber nachvollziehbar sein. Im „Stern“ heißt es an einer Stelle: „Mehr als ein Dutzend Mitarbeiter und Assistentinnen haben sich dem Reporterteam anvertraut.“ Sind es tatsächlich „Mitarbeiter“, also auch Männer? Ein paar Zeilen weiter werden jedenfalls „mehr als ein Dutzend Frauen“ indirekt zitiert. Im Text steht als mögliche Begründung für diese widersprüchlichen Formulierung nur, die Personen fürchteten „berufliche Konsequenzen“. Wie viele es genau sind, dazu macht der Text keine Angaben. Auch auf Anfrage teilt der „Stern“ das nicht mit.
Viel entscheidender ist jedoch die Perspektive, aus der die Quellen berichten. In solchen Fällen lassen sich drei Gruppen unterscheiden: Erstens Quellen, die selbst betroffen sind. Sie können unmittelbar aus ihrem Erleben schildern und die Beziehung zu der betreffenden Person aus ihrer Sicht einschätzen. Das kann für eine Recherche sehr eindrücklich, allerdings auch subjektiv gefärbt sein.
Zweitens gibt es Quellen, die die vorgeworfenen Handlungen beobachtet haben. Auch sie können aus eigenem Erleben schildern, sind aber nicht direkt betroffen und daher weniger subjektiv in ihrer Bewertung. Dafür fehlt ihnen aber möglicherweise wichtiges Wissen über die Beziehung zwischen den handelnden Personen.

Schließlich gibt es Personen, die nur mittelbar von den Vorwürfen erfahren. Sie können Journalisten höchstens berichten, was sie von anderen gehört haben – entweder von selbst betroffenen Personen, von Beobachtern oder nur von anderen Unbeteiligten. Letzteres wäre nur ein Gerücht.
In dem Artikel bleibt allerdings meist offen, ob die „mehr als ein Dutzend Frauen“ dem Reporterduo über ihre eigenen Erfahrungen, über selbst gemachte Beobachtungen oder nur über Gerüchte berichtet haben. Allein sechsmal schreibt der „Stern“ selbst von „Gerüchten“ um Gallée. Nicht aber, wenn er die Angaben seiner eigenen Quellen wiedergibt. Die Information, aus welcher Perspektive diese jeweils berichten, damit sich ihre Angaben von „Gerüchten“ unterscheiden, fehlt allerdings.
Nur eine Frau wird in dem Artikel namentlich genannt und direkt zitiert. Ihren echten Namen hat die Redaktion geändert, was in der MeToo-Berichterstattung üblich ist. Sie ist offenbar die Betroffene des Vorfalls bei der Klausurtagung in Frankreich. So bleibt offen: Waren es möglicherweise nur eine oder zwei Frauen, die selbst einen Vorfall mit Gallée erlebt haben, und die anderen Quellen haben nur vom Hörensagen von solchen Vorfällen erfahren? Diese Möglichkeit wäre von den Formulierungen im Text gedeckt.
Es könnte allerdings auch wesentlich belastender für Gallée ausfallen. Doch hätte der „Stern“ es dann nicht auch so schreiben können, hätte zumindest angeben können, wie viele seiner Quellen unmittelbar Betroffene sind – vermutlich auch, ohne die Identität der Frauen preiszugeben? Übermedien wollte daher wissen, wie sich die Quellen zusammensetzen. Doch der „Stern“ ist in seiner Antwort gar nicht erst darauf eingegangen.
Das alles heißt selbstverständlich nicht, dass an den Vorwürfen gegen Gallée nichts dran ist. Laut den meisten Studien bewegt sich der Anteil erfundener oder falscher Anschuldigungen bei sexueller Gewalt im einstelligen Prozentbereich. Es geht hier also nicht um Schuld oder Unschuld, sondern um journalistische Arbeit. Die Fragen dazu lauten: Kann der „Stern“ ausreichend darlegen, dass hinter jeder Schilderung in seinem Text ein tatsächliches Fehlverhalten oder eine belastbare Quelle steckt? Und wie sehr bemüht sich das Autorenduo, eine Vorverurteilung zu vermeiden?
Eindrücklich ist in diesem Zusammenhang, wie falsch viele andere Medien anhand des „Stern“-Berichts über den Fall berichtet haben. So wurden aus „mehr als einem Dutzend Frauen“, die sich dem „Stern“ wie auch immer anvertraut hatten, im „Fränkischen Tag“ kurzerhand „mehr als ein Dutzend Frauen […], die Gallée seit Sommer 2022 belästigt haben soll“. Der „Tagesspiegel“ behauptete: „Etliche Mitarbeiterinnen der Grünen in Brüssel sollen Gallée dem Bericht nach seit Sommer 2022 vorgeworfen haben, sie sexuell belästigt zu haben.“
Der TikTok-Kanal „aufgeflogen“ des MDR trieb es auf die Spitze: Er titelte in einem Video mit der knalligen Alliteration „Der Grabscher von den Grünen“. Mindestens 60.000 Menschen sahen den Clip. Die Moderatorin von „aufgeflogen“ schmückte den mutmaßlichen Vorfall bei Paris aus, als wäre sie selbst dabei gewesen („Gallée schmiegt sich eng von hinten an sie, fasst sie immer wieder an. Sie versucht zu entkommen, aber er macht weiter, bis sie die Situation fluchtartig verlässt.“) und setzte obendrauf: „Das war kein Einzelfall. Mehrere Frauen machen ähnliche Erfahrungen mit dem Politiker Gallée.“
Dieser sah sich durch die genannten Beiträge in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt und ging erfolgreich dagegen vor: „Tagesspiegel“ und „Fränkischer Tag“ gaben Unterlassungserklärungen ab, gegen den MDR gab es eine einstweilige Verfügung. Infolgedessen wurden die Beiträge depubliziert.
Nicht nur Medien, auch Politikerinnen hatten offenbar Schwierigkeiten mit der korrekten Lektüre des Artikels: In einem offenen Brief an die Grünen-Fraktionsspitze im EU-Parlament schrieb eine Gruppe von weiblichen Abgeordneten der konservativen EVP-Fraktion: „According to press reports, there have been sexual assaults on more than a dozen employees, group staff members and interns.“ („Medienberichten zufolge gab es sexuelle Übergriffe auf mehr als ein Dutzend Angestellte, Fraktionsmitarbeiterinnen und Praktikantinnen.“)
Die „Rheinische Post“ berichtete mit Verweis auf den Brief über „sexuelle Übergriffe auf mehr als ein Dutzend Mitarbeiterinnen von Abgeordneten, Fraktionsmitarbeiterinnen und Praktikantinnen“. Auch dagegen ging Gallée rechtlich vor und erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen die Zeitung aus Düsseldorf.
Man kann dem „Stern“ zwar nicht die Leseschwäche anderer vorwerfen – es ist aber mindestens auffällig, wie einhellig die Geschichte von anderen Medien interpretiert wurde.
Vieles an der Berichterstattung über Malte Gallée erinnert an den Fall Stefan Gelbhaar. Beide sind Grünen-Politiker, beide erlebten das vorläufige Ende ihrer politischen Karrieren nach Medienberichten über angebliche sexuelle Belästigung. Beide bestreiten die Vorwürfe vehement. Und in beiden Fällen spielen die parteiinternen Ombudsverfahren eine wichtige Rolle.
Diese Verfahren werden unter anderem bei Vorwürfen sexueller Belästigung eingeleitet, ihre Inhalte gelangen normalerweise nicht an die Öffentlichkeit. Doch der „Stern“ konnte darüber im Fall Gallée berichten: „Nach und nach räumt er (Gallée, d.Red.) ein, dass er Gespräche mit Ombudspersonen der Partei gehabt habe, weil ihm grenzüberschreitendes Verhalten vorgeworfen worden sei.“
Es liest sich wie ein Schuldeingeständnis. Dabei hatte Gallée nach eigener Aussage selbst die Ombudsleute bereits im Sommer 2022 eingeschaltet, um die Gerüchte, die schon damals um ihn kursierten, aufzuklären. Das erwähnt der „Stern“ auch, allerdings erst deutlich weiter hinten im Text.
Inzwischen erscheint das grüne Ombudssystem in neuem Licht: Laut der im Juni veröffentlichten Zusammenfassung des Berichts des Bundesvorstands im Fall Gelbhaar leide es an „erheblichen rechtsstaatlichen Defiziten und Definitionsmängeln“. Die Rechtsanwälte Jerzy Montag und Anne Lütkes, die den Bericht verfasst haben, betonen darin, dass nicht nur meldende, sondern auch gemeldete Menschen „Schutz und die gebotene Vertraulichkeit“ sowie ein „Recht auf ein faires Verfahren und eine vorbehaltlose Anhörung ihrer Sichtweise“ haben.
Heißt also: Statt an der Unschuldsvermutung orientierten sich die Grünen bis zuletzt im Zweifel an den Betroffenen, wie kürzlich auch Lena Marbacher im „Freitag“ kritisierte. Vor diesem Hintergrund sagt die reine Tatsache, dass Ombudsleute bei den Grünen tätig werden, noch nichts über die Substanz der Vorwürfe aus.
Im Fall Gallée waren sogar zwei Ombudsstellen tätig. Zum einen die seiner Fraktion im EU-Parlament. Nachdem er die dortigen Ombudsleute aufgefordert hatte, die Vorwürfe gegen ihn aufzuklären, passierte allerdings zwei Jahre lang nicht viel, obwohl bei der Stelle in dieser Zeit mehrere Beschwerden über Gallée eingingen. Erst durch die „Stern“-Recherche wurden diese öffentlich.
Im „Stern“ wird das als Versagen der Fraktionschefin Terry Reintke dargestellt. Ausgerechnet die Abgeordnete, die einst den Hashtag #MeTooEU startete. Dabei wäre es auch denkbar, dass es nachvollziehbare Gründe dafür gab, dieses Verfahren nicht weiter zu verfolgen. Genau sagen lässt sich das nicht, denn zu den Inhalten einzelner Verfahren hüllt sich die Partei in Schweigen. Diese Möglichkeit wird im „Stern“ allerdings nicht einmal erwähnt.

Das zweite Ombudsverfahren fand in Gallées Landesverband Bayern statt. Es wurde im Juni eingestellt. Entlastet wird Gallée dadurch allerdings nicht. Denn genauso wenig, wie die Eröffnung eines Verfahrens etwas über die Schuld aussagt, sagt dessen Einstellung etwas über die Unschuld aus. Auf Anfrage teilt eine Sprecherin der Grünen in Bayern mit: „Was Ombudsarbeit nicht tut und kann, ist Personen zu verurteilen oder freizusprechen – dafür sind allein Gerichte zuständig.“
Neben den beiden Ombudsverfahren wusste der „Stern“ noch über eine parteiinterne „informelle Untersuchung“ der Vorwürfe gegen Gallée zu berichten. Diese soll aufgrund von Druck aus der Berliner Geschäftsstelle eingeleitet worden sein. Dazu heißt es: „Nach Informationen des stern bestätigte die Untersuchung die Vorwürfe, die Frauen gegenüber Gallée erhoben hatten. Darunter jener der sexuellen Belästigung, unerwünschter Berührungen an Hintern und Hüfte und dass sich Gallée von hinten an Frauen angeschmiegt habe wie zum Beispiel beim Retreat nahe Paris.“ Auf den ersten Blick liest sich das wie ein Beleg für den einzig konkreten Vorwurf in dieser Recherche.
Deshalb würde man gerne mehr erfahren: Um was für eine Untersuchung genau soll es sich hier handeln? Inwiefern „bestätigt“ sie die Vorwürfe? Doch auch hier wird der „Stern“ nicht konkreter. Auf Nachfrage teilt eine Sprecherin nur mit, sie könne aus Quellenschutzgründen keine näheren Angaben dazu machen. Und: „Die Informationen basieren auf Angaben von unmittelbar an der Untersuchung Beteiligter.“ Malte Gallée war offenbar nicht daran beteiligt. Er erklärt auf Anfrage, er kenne diese Untersuchung auch nur aus dem Artikel und sei innerhalb der Partei nie dazu befragt worden. Ebenso wenig habe der „Stern“ ihn mit deren Inhalten konfrontiert.
Mit dem Wissen über die Grenzen der internen Verfahren bei den Grünen und den dürftigen Informationen aus dem „Stern“ kann man daraus also nicht viel mehr ablesen als die schlichte Bestätigung dafür, dass es diese Vorwürfe gegeben hat.
Gallée hat im Mai beim Hamburger Landgericht Klage gegen die Berichterstattung des „Stern“ eingereicht. Der will sich „selbstverständlich“ dagegen verteidigen, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilt. Der Artikel beruhe auf „einer umfangreichen Recherche, die alle journalistischen Sorgfaltspflichten erfüllt. Sämtliche Voraussetzungen einer zulässigen Verdachtsberichterstattung liegen vor.“
Wie so häufig im Zusammenhang mit MeToo-Berichterstattung wird also am Ende ein Gericht über deren Zulässigkeit entscheiden.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
Der größte Spaß ist nicht, wenn so ein Ikarus fällt, sondern, ihn zum fallen zu bringen.