Der Autor

Lukas Heinser ist freier Journalist und Autor. Seit 2007 betreibt er das Popkultur-Blog coffeeandtv.de, von 2010 bis 2014 leitete er das „BILDblog“.

Man konnte Franz Josef Wagner karikieren: Einfach ein paar Sexismen und Verweise auf Alkohol einstreuen, fertig war die holzschnittartige „Post“. Ihn zu imitieren war jedoch eigentlich unmöglich. All die Assoziationen, Volten und Haken, die schiefen (aber gerade deshalb mitunter eindrücklichen) Vergleiche, die originellen Formulierungen, die fröhlichen Kurzschlüsse zwischen Hoch- und Popkultur, zwischen Kirche und Kneipe, zwischen Banalität und Tiefgang – all das entsprang immer einem Hirn aus der Kategorie „Das etwas andere Gehirn“.
Als ich noch für das „BILDblog“ gearbeitet habe und zwischen 2009 und 2014 eigentlich jeden Tag dienstlich „Bild“ lesen musste, war die Kolumne „Post von Wagner“ fester Bestandteil meines Alltags: An wen hat er diesmal und was hat er jetzt wieder geschrieben – und was würden wir darüber bloggen müssen?
Wagner war der Mann, der Frauen (aber auch Männer) auf ihr Äußeres reduzierte oder sie als „Mädchen“ bezeichnete, der rassistische Stereotype referierte, der verlässlich seine Meinung änderte, der teils verstörende Auffassungen von Schuld und Sühne, Justiz und Psychiatrie vertrat, der einem 17-Jährigen, der wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs einer 13-Jährigen in der Türkei im Gefängnis saß, die „Frauen“ so erklärte: „Wenn sie ja sagen, meinen sie nein. Und wenn sie nein sagen, meinen sie ja.“ Und Wagner war der, der seinem Arbeitgeber hohe Schmerzensgeldzahlungen einbrockte, der sich regelmäßig bei einfachen Fakten irrte und sich verrechnete.
Aber er war eben auch jemand, der in seiner Kolumne indirekt jene Zeitung kritisierte, in der sie abgedruckt wurde; der sich als alter Rock’n’Roller, als Humanist und Feminist zu erkennen gab – und der in einer zunehmen polarisierten Welt, einer aufgescheuchten Medienbranche, vor allem aber in einer „Bild“-Zeitung, die ihre Kulturkampftraditionen der späten 1960er Jahre wieder aufwärmte, zuletzt immer öfter Graustufen suchte, Neugier und echtes Interesse erkennen ließ und sich so als Stimme der Vernunft präsentierte, wo die meisten anderen durcheinanderkreischten wie alle polyphonen Klingeltöne aus dem Jamba-Sparabo gleichzeitig.
Man schiebt ja immer gerne Vieles auf die Kindheit, und Franz Josef Wagner hat viel über seine geschrieben: Wie die Mutter mit ihm und seinem Bruder aus dem „Protektorat Böhmen und Mähren“ floh, wie der Vater erst spät aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrte, wie er sich oft fehl am Platz fühlte und ihm die neue Heimat bald zu klein wurde.
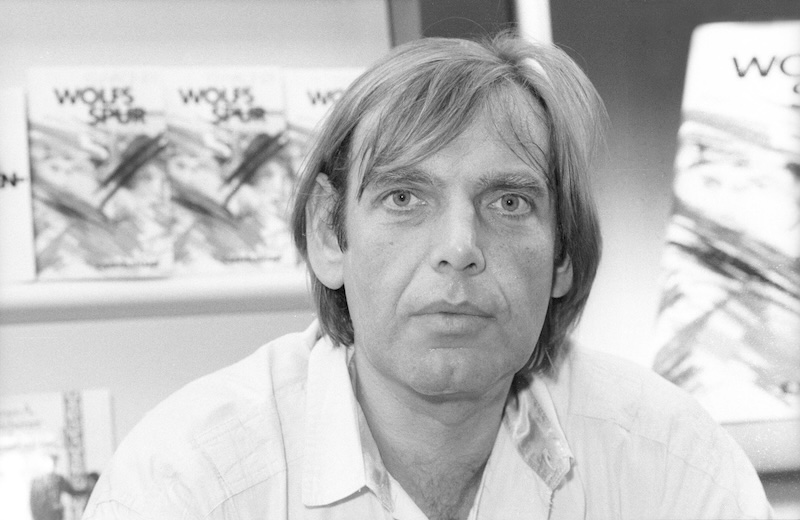
Wagners weitere Lebensgeschichte klingt wie ein Roman zwischen Jack Kerouac und Hubert Fichte – oder halt wie einer von Wagner selbst: Durchschlagen in Genf, Paris und München; Rumhängen mit Andreas Baader; Kriegsreporter in Israel und Vietnam. Ein Mann, wie geschaffen für Lederjacke, Kippe und Motorrad, für eine Verfilmung mit Jean-Paul Belmondo oder Manfred Krug in der Hauptrolle (nur, dass die etwas älter waren). Und bis zum Schluss auch einer, der das alles bisher überlebt hatte: die Kriege, die Frauen, den Job, die Arterien (die seinen Freund Bernd Eichinger getötet hatten), die Nächte in Bars und das Alter.
In seinem Buch „Brief an Deutschland“ – ein schmales Büchlein, zu etwa gleichen Teilen Autobiographie, Schaffensbericht und gewohnt melancholisch-irrlichternder Stream of Wagnerness, und unbedingt lesenswert – hatte Wagner eine der besten Beschreibungen des eigenens Berufsbilds abgegeben:
„Einen Reporter zu definieren ist nicht leicht. Nach der Story geht er Bier trinken. In einer Kneipe sitzen, rauchen, den ersten Satz noch einmal umformulieren, ein zweites Bier. Zu 60 Prozent besteht ein Reporter aus Neugier, mit dem Rest ist er unzufrieden. Wenn eine Story zu Ende ist, dann ist er es auch irgendwie. Ohne Story ist ein Reporter nicht viel, wie ein Vampir tagsüber. Meist ist sein Privatleben eine Katastrophe. Der klassische Reporter lebt getrennt oder ist geschieden, er hat ein Kind und wohnt in einem modernen Apartmenthaus, seine Nachbarn kennt er nicht. Ein Gerichtsvollzieher hätte keine Freude an ihm. Bett, Stuhl, Tisch, Kleiderstange statt Schrank, Computer. Der klassische Reporter findet sich überall zurecht, nur nicht in seinem eigenen Leben.“
Im Laufe seiner Karriere hatte Wagner Schlagzeilen verantwortet wie „Pandabärin unfruchtbar – Aber Schumi zweites Baby“ („B.Z.“) oder „Angeber-Wessi mit Bierflasche erschlagen – Ganz Bernau ist glücklich, daß er tot ist“ („Super!“), die wahrscheinlich auch in 50 Jahren noch an Journalismusschulen gelehrt werden dürften, wenn auch noch nicht ganz klar ist, ob als gutes oder schlechtes Beispiel. Seinen Job als Chefredakteur der „B.Z.“ verlor er, nachdem er auf der Titelseite die Schwimmerin Franziska van Almsick geschmäht hatte: „Franziska van Speck – als Molch holt man kein Gold“.
Wenn man nach so einer Geschichte doch noch weitermachen darf, raunen die sogenannten Kreise gern, der Betreffende habe irgendetwas gegen die eigenen Vorgesetzten „in der Hand“. Vielleicht wollte Kai Diekmann, als er Anfang 2001 Chefredakteur von „Bild“ wurde, einfach nur eine Art Raucherecke in seiner Zeitung einrichten; vielleicht hoffte man bei Springer, dass Wagner seine Aufgabe als „Chefkolumnist“ vor allem als Kolumnist interpretieren würde und weniger als Chef (in dieser Funktion hatte er überall Schneisen der Verwüstung hinterlassen, in den letzten Monaten bei der „B.Z.“ allerdings ganze Landstriche abgeräumt). Und so entstand die „Post von Wagner“.
Spätestens von da an klebte an Wagner das nichtssagende Etikett „Kult“. Benjamin von Stuckrad-Barre schrieb über ihn; Bildungsbürger lasen seine Texte „ironisch“ und ließen sich originelle Bezeichnungen für ihn einfallen; die ARD widmete ihm eine Reportage, in der er, der schon von zuhause arbeitete, als das Wort „Homeoffice“ noch nicht erfunden war, dann eben doch mal das Springer-Hauptquartier besuchen wollte und erst den Eingang nicht fand und dann die Sekretärin mit seiner Anwesenheit verstörte. Für einen Mann, der pro Tag etwa 40 Zeilen Text abliefern musste, bekam er ganz schön viel Aufmerksamkeit – aber diese Verdichtung, die war es natürlich, die ihn so berühmt machte.
An Uli Hoeneß schrieb er zu dessen 65. Geburtstag: „Leider muss ich mit einem Distelstrauch gratulieren.“ Donald Trump attestierte er: „Irgendwie liest sich Ihr Leben wie ein Schundroman.“ Und als er nach einem Oberschenkelbruch im Alter von 68 Jahren drei Wochen Zwangspause einlegen musste, nahm er seine „lieben Brieffreunde“ mit in den Moment, als es passierte: „Es ist fünf Uhr morgens, die Digitaluhr leuchtet. Ich muss pinkeln. Ich stehe auf und stolpere auf dem Weg zum Klo über meinen Urlaubskoffer“.
Im Sommer 2013, nachdem Wagner einen Brief an den „bösen Bushido“ geschrieben hatte, kamen die Kolleg*innen von Bild.de auf die beknackte, in Wagners Kopf also möglicherweise total naheliegende Idee, ihn diesen Text mit seiner Berner-Sennenhund-Stimme vorlesen zu lassen und mit einem generischen Hip-Hop-Beat zu unterlegen.
Zu dieser Zeit, ungefähr zwischen 2011 und 2014, war ich mit einer Reihe von Nachtfreunden (auch eine Vokabel, die wir von Wagner übernommen hatten: „Wir sind Nachtfreunde. Ich habe Dich immer nur nachts getroffen“, hatte Wagner an den Schauspieler Otto Sander geschrieben, als er dessen Tod betrauerte) in einer Facebook-Gruppe namens „Die Wagner-Vorhersage“ aktiv: Jeden Abend gaben wir uns Mühe, Adressat*in und Formulierungen der kommenden Kolumne zu antizipieren, es gab ein komplexes Punktesystem und wenn wirklich mal jemand das (s.o.) eigentlich Unmögliche vollbracht und einen Wagner-Gedanken passgenau orakelt hatte, dann gab es ein großes Hallo, Alkohol und einen Schauder wie bei „X-Factor“, wenn Jonathan Frakes gerade erklärt hatte, dass eine besonders gruselige Geschichte wirklich passiert war.
Im Juli dieses Jahres, mitten in der Aufregung um die Nicht-Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin, schrieb er: „Ich glaube, solche Frauen brauchen wir.“ Und das war dann für mich Grund und Anlass genug, in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ eine kritische Würdigung von Wagners Spätwerk zu formulieren.
Als ich ein paar Wochen später in Berlin war, schaute ich mittags in der (nicht nur) durch Wagners Kolumnen zu Berühmtheit gekommenen Paris Bar an der Kantstraße vorbei: Es hätte ja sein können, dass er zufällig da war (im fortgeschrittenen Alter vielleicht eher „schon“ als „noch“). Ich hätte ihn auf meinen Artikel angesprochen und mich als Autor zu erkennen gegeben. Doch er war nicht da und so sind wir uns nie direkt begegnet.
Seine letzte reguläre „Post“ schrieb Wagner, der alte Katholik und ehemalige Regensburger Domspatz, am 8. September an Carlo Acutis, einen Teenager, der gerade von Papst Leo heiliggesprochen worden war. Am 25. September hieß es an der üblichen Stelle auf Seite 2: „auch ein Franz Josef braucht mal eine Pause. Aber ich freue mich, schon bald wieder für Sie zu schreiben.“ Ungefähr zu dieser Zeit muss Wagner mit dem Rauchen aufgehört haben, wie sein „Bild“-Kollege Norbert Körzdörfer heute in seinem Nachruf enthüllt. Und dann ist Franz Josef Wagner einfach gestorben.
Mit 68 Jahren hatte er erklärt:
„Arbeiten ist Glück.
Ich jedenfalls kann mir ein Leben ohne Arbeit nicht vorstellen. Das Leben ist für mich ein Fahrrad, man trampelt und trampelt, und wenn man nicht mehr trampelt, fällt das Fahrrad um.“
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
Der Nachruf verwundert mich, ich hätte ihn so nicht erwartet. Ich kann ihm aber etwas abgewinnen, da er ein anderes Licht auf FJW wirft als das, unter welchem ich seine Texte immer gelesen habe. Chapeau!
Er hat so geschrieben, als würde er delirieren und fiebern. Dabei kamen manchmal fürchterliche, oft aber auch genialische Texte heraus. Seine ungemein originelle Art wird fehlen.
Gut möglich, dass Wagner mehr Diekmann-Bild als Reichelt-Bild war. Aber verletzender Irrsinn wirkt halt auch nur im Vergleich zu bösartiger Hetze vorteilhaft. Oder mit anderen Worten: Dass Wagner auf einmal nicht mehr wie der Irrste in dem Laden schien, spricht nicht unbedingt für ihn. Insofern halte ich das Ende der Kolumne für keinen Verlust. Vielleicht lassen sie ihn ja auch als KI weiterleben. Wäre sicherlich in Döpfners Sinne.
Interessant, aber wann genau gab sich denn Franz Josef Wagner als Feminist zu erkennen? Kurz vor dem Ende Frauke Brosius-Gersdorf gut finden macht aus einem Sexisten noch keinen Feministen… und aus einem Bildkolumnisten keinen Humanisten.
Wagner, ein Name, der nie etwas gutes verspricht: Egal ob es sich nun um Klassische Musik, italienisch anmutende Tiefkühlkost, russische Söldnertruppen oder um sogenannten Journalismus dreht. Die Welt hat einen weniger jetzt.
Springer-Presse bleibt Springer-Presse. Wagner war nur ein geduldeter Hofnarr.