
„Zeit Magazin“ tritt zur Ehrenrettung der Polizei an

Als Leser ist man dankbar, wenn journalistische Texte gleich im ersten Satz klarmachen, worum es geht. So ist es auch in der Titelgeschichte im „Zeit Magazin“ vom 7. August, da steht:
„An einem Tag im Juli ruft Thomas Bergmann seine Leute zusammen, um die Ehre der Berliner Polizei zu retten.“
Je weiter man liest, desto mehr entsteht der Eindruck, als verfolge der Text von Autor Jörg Burger dasselbe Ziel: die Ehre der Polizei zu retten.
Die Polizisten Thomas Bergmann und Stefan Pauli sind die Hauptprotagonisten der Geschichte und heißen eigentlich anders. Sie wurden zu ihrem Schutz umbenannt. Bergmann und Pauli sind Teil der sogenannten „Ermittlungsgruppe Nahost“, einer Polizeitruppe in Berlin, die nach dem terroristischen Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 gegründet wurde. Ihre offizielle Aufgabe: Gewalt und Hetzparolen auf propalästinensischen Protesten unterbinden, mögliche Straftäter verhaften.
Doch wie der Autor durchblicken lässt, geht es auch um ein bisschen mehr als das: Polizist Pauli „verteidigt die Staatsräson, das ist sein Job“, heißt es da. Die Staatsräson, also: Deutschlands bedingungslose Solidarität mit Israel. Manche Kritiker meinen auch: Solidarität, mitten in einem Krieg, mit einer teils rechtsextremen Regierung, deren Armee in Gaza 60.000 Menschen getötet hat, die dortige Bevölkerung offenbar gezielt aushungert und dabei auch das Leben der israelischen Geiseln aufs Spiel setzt. Aber davon ist im „Zeit Magazin“ nichts zu lesen.
Der Text gibt fast ausnahmslos die Sicht der Mitglieder der „Ermittlungsgruppe Nahost“ wieder. Redakteur Jörg Burger darf die Polizisten exklusiv bei ihren Einsätzen begleiten, bei Hausdurchsuchungen, Demonstrationen und Besprechungen im Hauptquartier. Er erzählt dabei vom Hass, der den Beamten entgegenschlägt, von ihrem Kindheitstraum, etwas „Gutes“ für die Gesellschaft zu tun, von der Aufregung vor ihren Einsätzen oder von ihrem Unverständnis gegenüber der Wut der Demonstranten („Ich kann schon verstehen, dass die Leute auf die Straße gehen. Aber wogegen richtet sich diese Wut, hier in Deutschland?“).
Helden und Opfer
Immer wieder präsentiert das „Zeit Magazin“ dabei die Polizisten als Helden und Opfer zugleich. Über einen Einsatz bei einer Demo heißt es zum Beispiel:
„Es sieht so aus, als richte sich die Demonstration allein gegen die Polizei, die die Ausübung der Versammlungsfreiheit doch erst ermöglicht, indem sie die Friedlichen schützt.“
Ein bisschen erinnert der Beitrag im „Zeit Magazin“ an Kriminalserien aus Polizeisicht, wie „Soko München“ oder „Polizeiruf 110“. Der Zuschauer erlebt die Polizeieinsätze hautnah mit, dafür erfährt er aber auch nur die Perspektive der Beamten, erlebt sie als nett und höflich, mutig und humorvoll, und identifiziert sich mit ihnen.
In der Medienforschung gibt es einen Begriff dafür: Copaganda, ein Kofferwort aus „Cop“ und „Propaganda“: die unreflektiert einseitig-positive mediale Darstellung von Sicherheitsbehörden.
Wer Zugang hat, entscheidet die Polizei
Für den Journalisten Mohamed Amjahid, Autor des Sachbuches über Polizeigewalt „Alles nur Einzelfälle?“, ist diese Form der Polizeiberichterstattung in deutschen Redaktionen ein strukturelles Problem, wie er auf Anfrage von Übermedien schreibt: „Es gibt in Deutschland keinen Rechtsanspruch auf eine journalistische Begleitung von Polizist*innen. Demnach können Polizeibehörden Zugänge verweigern und sich jene Medienvertreter*innen aussuchen, die garantiert positiv über die Polizei berichten werden.“ Vor diesem Hintergrund sei aus Sicht Amjahids auch die Titelgeschichte im „Zeit Magazin“ zu bewerten.
Während die Polizisten dem Leser als menschliche, mehr oder weniger vernunftbegabte Wesen begegnen, mit Hoffnungen, Ängsten und individuellen Lebensgeschichten, sind die Demonstranten im Text überwiegend eine gestaltlose Masse, die dem Leser mal als „gewaltbereite Linke“, „radikalisierte Palästinensischstämmige“ oder, noch etwas pauschaler, als „gewalttätige Klientel“ präsentiert wird. Dabei wirft der Autor im Text mehrmals die – offenbar rhetorische – Frage auf, woher die Wut der Demonstranten kommt. 5000 Worte ist der Text lang, aber kein einziges Mal macht sich der Autor die Mühe, eine Antwort darauf zu suchen oder gar mit einem Demonstranten zu sprechen.
Zwei Mal werden einzelne Demonstranten zwar genannt: ein Mann aus einer aus Gaza stammenden Familie, dem mehrere Straftaten vorgeworfen werden, und die Aktivistin Yasemin Acar, die als „Pro-Palästina-Extremistin“ bezeichnet wird. Mit ihnen gesprochen hat der Autor allerdings nicht. Zugleich zitiert er – völlig unironisch – einen Polizisten, der den Großteil der Demonstranten als Menschen bezeichnet, die „nicht willens oder in der Lage (sind), sich mit einer anderen Sicht auseinanderzusetzen“.
Auf Anfrage verneint eine Verlagssprecherin der „Zeit“, dass die Polizei für die redaktionelle Arbeit Bedingungen gestellt hat. Auf die Frage, ob der Autor bereits in der Anfrage an die Polizei signalisiert habe, dass der Bericht in deren Interesse ausfallen wird, gibt sie keine Auskunft.
Kritik von Amnesty und Europarat wird nicht erwähnt
Was der Text an keiner Stelle erwähnt: Im April kritisierte die Organisation Amnesty International in ihrem Jahresbericht, dass die deutsche Polizei bei Protesten für ein Ende des Gazakrieges mit „exzessiver Gewalt“ gegen Demonstranten vorgegangen sei. Im Juni kritisierte auch der Menschenrechtskommissar des Europarats, Michael O’Flaherty, in einem Brief an Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), dass die Polizei bei Protesten teils zu viel Gewalt anwende und das Versammlungsrecht einschränke. Er bezog sich darin auch konkret auf Demos in Berlin.
Seit Beginn des Gaza-Krieges stößt man im Netz immer wieder auf verstörende Videoaufnahmen. Man sieht zum Beispiel, wie Berliner Polizisten auf Menschen losgehen, sie mehrmals ins Gesicht boxen, eine Frau am Kopf packen und ihn gegen einen Polizeiwagen schlagen. Zahlreiche Demonstranten wurden durch Polizisten verletzt. Das wird im Text nur an zwei Stellen beiläufig thematisiert, beispielsweise so:
„Was die Polizei auch tut, sie kann nur verlieren. Einen Straftäter zu verhaften, bedeutet, ihn mit Gewalt aus der Menge zu holen.“
Neben der Gewalt gegen Demonstranten kritisiert der Menschenrechtsbeauftragte des Europarates auch pauschale Versammlungsverbote, das Verbot anderer Sprachen außer Deutsch und Englisch auf Gaza-Protesten sowie ein pauschales Verbot kultureller Symbole, gemeint ist damit vermutlich die Kufiyeh, das sogenannte Palästinensertuch.
Auffällig ist, wie das „Zeit Magazin“ die genannten Vorwürfe gegen die Polizei fast ausschließlich aus Sicht der Polizei bewertet oder höchstens am Rande, ohne weitere Einordnung, erwähnt.
Als beispielsweise eine angemeldete Demonstration verboten wird, ist das für den Autor kein Grund, die Einschränkungen, sondern nur die Erleichterung der Polizei zu thematisieren:
„In letzter Minute hat ein Gericht verboten, dass die Demonstration durch Kreuzberg und Neukölln ziehen kann, nur eine Kundgebung hier am Platz wurde erlaubt. Pauli ist erleichtert.“
Getötete Kinder – verbotene Gewaltdarstellung?
Von Symbolen von Terrororganisationen oder offener Menschenfeindlichkeit bei den Demonstrationen kann der Autor offenbar nicht berichten. Stattdessen geht es um „Free Palestine“-Graffitos, Transparente der „Linken“ oder palästinensische Flaggen, als handele es sich um etwas Verpöntes. An einer Stelle berichtet der Autor, wie die Polizei ein Plakat konfiszieren lässt, auf dem „umgekommene“ Kinder dargestellt sind. Auch hier geht er nicht auf die Tötung von bislang 18.000 Kindern in Gaza ein, sondern beschränkt sich auf die Sicht der Polizei, die das Plakat als „verbotene Gewaltdarstellung“ einstuft. Bemerkenswert ist auch, wie das politische Verbot eines propalästinensischen Slogans verteidigt wird:
„Vor dem 7. Oktober bekam niemand Scherereien, der ‚From the river to the sea, Palestine will be free‘ skandierte. Wer heute ‚From the river to the sea‘ bei einer Demonstration ruft, kann festgenommen werden, weil klar ist, dies ist die Aufforderung, den Staat Israel auszulöschen und alle Juden zu töten – Anzeige wegen Volksverhetzung.“
Schon vor Erscheinen des Textes haben deutsche Gerichte geurteilt, dass der Slogan keine Straftat darstelle. Diese Sichtweise deckt sich mit einem Gutachten des Berliner Landeskriminalamts, wonach die Parole ursprünglich für einen „multiethnischen, säkularen Staat auf dem ehemaligen britischen Mandatsgebiet Palästina“ gestanden habe und daher nicht automatisch mit einem Aufruf zur Auslöschung Israels oder gar aller Juden verbunden sei.
Ein entsprechendes Gerichtsurteil erwähnt der Autor zwar, lässt die Gerichte aber so dastehen, als würden sie den Kampf der Politik gegen Antisemitismus behindern:
„Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat vorgegeben, antisemitische Straftaten ‚mit aller Härte‘ zu verfolgen, die Gerichte sehen das hinterher manchmal anders.“
Unterschiedliche Erzählungen nach „Nakba-Day“
Worin liegt nun aus Sicht des „Zeit Magazin“ die beschädigte Ehre, die die Polizei retten muss? Es ist nicht die „exzessive Polizeigewalt“, die Menschenrechtsorganisationen kritisieren, sondern eine Recherche von Journalistenkollegen der „Süddeutschen Zeitung“ und des NDR.
Als bei einem Protest in Berlin zum „Nakba-Day“ am 15. Mai 2025 – dem Tag, an dem an die Vertreibung von 700.000 Palästinensern im Jahr 1948 erinnert wurde – ein Polizist verletzt wurde und mit einer gebrochenen Hand und Prellungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, inszenierte sich die Polizei zunächst als Opfer. Ein Polizeisprecher behauptete, der verletzte Polizist sei durch Demonstranten von seiner Gruppe getrennt und zu Boden gebracht worden, daraufhin habe man auf ihm „herumgetrampelt“.
Der Fall schlug hohe Wellen, Innenminister Dobrindt forderte im Bundestag mehr Rückendeckung für die Polizei. Doch die Recherchen der SZ und des NDR widerlegten auf Grundlage eines neu aufgetauchten Videos die Darstellung der Polizei: Weder wurde der Beamte von seiner Mannschaft getrennt noch von Demonstranten zu Boden gebracht. Die mithilfe des gemeinnützigen Vereins Forensis ausgewerteten Videos zeigten, wie der später verletzte Polizist sich selbst hinkniete, um einen am Boden liegenden Demonstranten zu fixieren, es folgten Rangeleien, am Ende wurde der verletzte Beamte von Kollegen weggebracht.
Im RBB kritisierte der ehemalige Polizeiausbilder Clemens Arzt, die Polizei habe „frühzeitig eskaliert“. Diesen Vorwurf erwähnt auch das „Zeit Magazin“. Es ist eine der wenigen Stellen, in der eine andere Perspektive als die der Berliner Spezialtruppe zu lesen ist. Dennoch schiebt der Text sofort die Sichtweise des Polizisten Pauli hinterher:
„Würde es die Gewaltbereiten besänftigen, wenn die Polizei sich mehr zurückhielte? Darüber grübelt er manchmal nach, er kommt aber zu dem Schluss: ‚Bei diesen Leuten ist mit guten Worten nichts erreicht.‘“
Ein Satz, der fast wie eine Lizenz zur Gewalteskalation klingt.
Auch nach den Hausdurchsuchungen bei Beteiligten an der Nakba-Demo am 15. Mai, die der „Zeit Magazin“-Autor exklusiv begleiten durfte, ist kein neues Beweismaterial bekannt, das die Darstellung der Polizei stützt; die Auswertung des Materials sei noch in Gange. Somit bleibt auch dem „Zeit Magazin“ nichts übrig, als den Aussagen des Polizisten Pauli einfach zu glauben:
„Wir haben nicht gelogen. Wenn ein Polizist am Boden liegt in so einer Situation, da ist es schwierig, eindeutige Aussagen zu treffen.“
Die „Ehre“ der Berliner Polizei ist bislang also noch nicht gerettet. Aber das „Zeit Magazin“ hat es zumindest versucht.
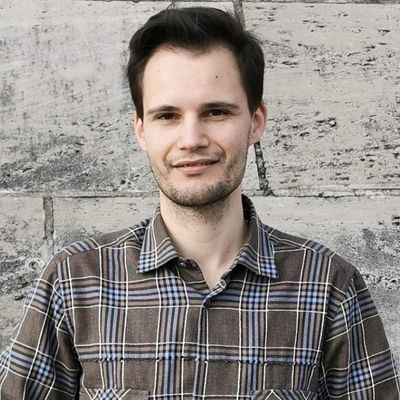
Bedenklich ist ja schon, dass man eine „Ermittlungsgruppe“ begleitet, die die Ehre der Polizei retten will. Was ermitteln die denn dann? Nur gegen „Nahost“ und nur im Sinne dieses Ziels? Laut den ersten Sätzen des Zeitartikels vor der Paywall sind das ja Zivilermittler, also eben nicht die Uniformierten, die auf der Demo „die Friedlichen schützen“ und deren Ehre in Gefahr ist (auch dieser Satz sei mal so dahingestellt. Auch friedliche Demonstrant*innen fühlen sich häufig von der sie umgebenden Polizei nicht unbedingt „geschützt“). Hätte man nicht alleine das schon hinterfragen müssen?
Vielleicht sollte man auch einfach mal auf so eine Demo gehen oder sie vom Rand beobachten. Vielleicht kann man danach auch den Zeit Blickwinkel verstehen.
Ich kann – auch nach der Lektüre des Artikels nicht erkennen, was hier problematisch sein soll: Es ist ein Report, der die Sicht der Polizisten darstellen WILL und das auch von Satz eins an offen zeigt. Das ist doch ein legitimes und interessantes Leseinteresse.
Etwas anderes ist es, wenn in scheinbar neutralen Meldungen/News allein oder vor allem die Sicht der Polizei präsentiert wird.
Aber hier sehe ich echt kein Problem…
@butterchicken:
So etwas wie „gerechter Volkszorn“ siegt über den Rechtsstaat?
Sie erinnern mich an jene Sorte Menschen, die die liberale Demokratie – ja, die Demokratie an sich – im Grunde verachten.
Ob in Gaza oder auf Berlins Straßen: Gesetze sind für sie nur ein Handicap. Da muss man schon mal Fünfe gerade sein lassen. Schließlich, so die Erzählung, machen diese Männer sich die Hände schmutzig, damit der verweichlichte liberale Westler ruhig schlafen kann.
@Chateaudur:
Also bemerkenswert ist bei der Zeit schon das wiederkehrende Framing uns angeblich hassender Menschen aus islamischen Ländern.
2015 Sie hassen uns: Viele Araber bejubeln in den sozialen Medien die Attentate von Paris.
2016 „Sie hassen uns“: Polen warnt vor Flüchtlingen, die Europa zerstören wollen.
2025 Pro-Palästina-Demos: „Die hassen uns“.
Es lassen sich bestimmt noch mehr solche Überschriften finden. Da wird schon ein Narrativ bedient.
Interessantes Video. Es zeigt, dass nicht nur „Rangeleien“ folgten, sondern der Polizist schlug mehrfach auf verschiedene Demonstranten mit seiner rechten Hand ein – die er offenbar unmittelbar danach als verletzt erkennt.
Frank, ich finde Deine Unterstellung widerwärtig und hochgradig unanständig.
Du drehst mir das Wort im Mund herum und vergiftest (wie so oft hier) die Diskussion.
Wieso machst Du sowas und warst Du jemals auf einer solchen Demo?
Ich übrigens schon.
Butterchicken, ich unterstelle dir nichts.
Du behauptest, es gäbe ein Verhalten von Demonstrationsteilnehmern, das rechtswidriges Handeln von Beamt:innen durch Sonderregeln legalisiere.
Das entspricht nicht meinem Demokratieverständnis.
Embedded Journalism ist immer nur ein Abbild, nie echter Ersatz für freie Berichterstattung. Die Polizei sollte in Konflikten, zu deren Schlichtung sie berufen ist, niemals Partei ergreifen – tatsächlich tut sie es nachweislich immer wieder. Dabei stinkt der Fisch oft vom Kopf. Polizeiführer Dudde in Hamburg ist ein Beispiel: Seine Einsatzbefehle wurden wiederholt von Verwaltungsgerichten gerügt, ohne dass ihn das von Wiederholungen abhielt – Urteile kommen Jahre später und bleiben folgenlos.
Legenden wie die angebliche Todesfalle in der Rigaer Straße (elektrifizierte Haustür) oder Schrödingers Molotow-Cocktails auf dem Dach an der Hamburger Schanze beim G20 werden in die Welt gesetzt, um ein Vorgehen zu legitimieren, das sich im Nachhinein als illegal erweist.
Eine echte Kontrolle der Polizei gibt es nicht – und gerade wir sollten es eigentlich besser wissen.
Ob „embedded“ berichten oder „Ehre retten“ – beides schadet unabhängiger Berichterstattung.
Zu #6
und solche Vorfälle kommen in die Statistik als Gewalt gegen Polizist. Und nein dass ist kein Scherz falls es jemand denkt.
zum Text
„Würde es die Gewaltbereiten besänftigen, wenn die Polizei sich mehr zurückhielte? Darüber grübelt er manchmal nach, er kommt aber zu dem Schluss: ‚Bei diesen Leuten ist mit guten Worten nichts erreicht.‘“
Es sollte eigentlich bekannt sein dass Gewalt fast immer zu Gegengewalt führt. Ich unterstelle den Polizisten die so denken, dass sie es drauf anlegen dass es eskaliert. Und schon kann man ordentlich reinknüppeln.
Das ist dann für jeden dieser „Einzelfall“ Polizisten die zu weit rechts stehen ein wahres Fest. Es sind ja eigentlich nur muslimisch aussehende Menschen und Linke auf so einem Protest.
Polizeigewerkschaften greifen gern auf Sätze wie „Die Polizei ist nur ein Spiegel unserer Gesellschaft!“ zurück.
Nein, ist sie nicht. Ebenso falsch ist die Annahme, alle Beamt:innen hätten den „Kindheitstraum“ gehabt, etwas „Gutes“ für die Gesellschaft zu tun. Selbst dort, wo dieser Wunsch tatsächlich vorhanden ist, kann die Vorstellung vom „Guten“ sehr unterschiedlich ausfallen.
Berufsbilder filtern automatisch den Personenkreis, der sich für sie interessiert – das gilt für alle Berufe, aber besonders für solche, die Uniform, Waffe, Privilegien und Autorität mit Hilfsleistung und Schutz verbinden.
Zu behaupten, Polizist:innen seien per se altruistisch, ist ebenso falsch wie das pauschale Bild vom „rechten Schläger“. Ein „Spiegel der Gesellschaft“ sind sie aber nicht.
Das ist kein Vorwurf, sondern eine Feststellung, der man Rechnung tragen muss.
Was gar nicht geht, ist der sogenannte „Korpsgeist“, der dafür sorgt, dass Verfehlungen Einzelner in der Regel folgenlos bleiben. Ebenso ist es falsch, dass die Polizei bei solchen Fällen selbst ermitteln sollte – das ist eine Binsenweisheit.
Nun zu Berlin:
Vielleicht lohnt sich ein Blick in den Beitrag von Abdul Kader Chahin aus Die Anstalt:
https://www.youtube.com/watch?v=rdFjUiItCgM
Wir schaffen uns Probleme, die später mit Geld für Polizeibewaffnung und Rekordzahlen an Abschiebungen „gelöst“ werden sollen – beides laut Studien maximal ineffektiv, aber eben populär und populistisch.
Nennt die Polizei das wirklich unironisch Ehre bzw. Ehrenrettung, oder hat sich die ZEIT dieses Wording selbst ausgedacht?
Natürlich würden sich Journalisten niemals mit der Sache gemein machen, über die sie berichten.
Man stelle sich das vor – heute sind die Polizisten menschliche Wesen und die Demonstranten eine gesichtslose Masse, morgen sind die Demonstranten die Menschen und die Polizei der Mob, einfach in Abhängigkeit davon, mit wem der Journalist gerade redet.
Die Dokumentation habe ich nicht gelesen,
dazu kein Kommentar.
Ich war auf ein paar Mahnwachen / Demos für die Geiseln. Der Hass, die Aggressivität, die dieser kleinen Gruppe, meist älteren Menschen entgegenschlug, war körperlich spürbar.
Der Polizei stehe ich, auch aufgrund eigener Erfahrungen, kritisch gegenüber.
An diesen Tagen hat sie, da bin ich sicher, Lynchjustiz verhindert. Die zitierte Aussage mit den „guten Worten“ unterschreibe ich aus eigener Erfahrung.
Ich spreche hier von Hannover, nicht Neukölln.